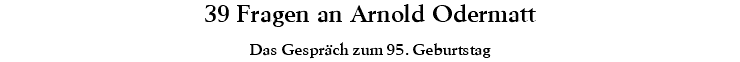
Was ist Photographie für Sie?
Photographie war der Ausweg. Bei meinem Eintritt in die Kantonspolizei Nidwalden vor über siebzig Jahren bekam ich die Aufgabe, Autounfälle mit Bleistift, später mit Tusche zu skizzieren. Ich konnte nicht zeichnen und photographierte die Autounfälle vom Standpunkt, an dem die Übersichtsskizze entstanden wäre. Gegen den Willen und zum Entsetzen meines Vorgesetzten. Er kannte die Photographie nicht und war überzeugt, daß Photos – anders als Bleistiftzeichnungen – Fälschungen Tür und Tor öffneten. Mein Vorgesetzter hielt mir ein Hotelplakat unseres Hausbergs Stanserhorn – der Photograph hatte für Touristen das Matterhorn mittels Doppelbelichtung in den Bildhintergrund montiert – unter die Nase: der Beweis für die Lüge der Photographie!
Später war ich Zeuge, wie ein Richter meinen Vorgesetzten überschwenglich für die Einführung der Photographie bei Ermittlung und Protokoll lobte. Mein Vorgesetzter drehte auf der Stelle und verfügte, daß Polizeibeamte Autounfälle künftig nicht mehr skizzierten, sondern photographierten. Ich war freilich der einzige, der wußte, wie man einen Film in die Kamera legte.
1925 wurden Sie in Oberdorf, Nidwalden, geboren. Wie war die Jugend?
Wir waren elf Kinder, sechs Buben und ein paar Mädels. Wir lebten, von was Garten und Stall hergaben. Der Vater war Kantonsförster und als Kavallerist – wie die meisten Nidwaldner – fast immer in der Armee. Die Mutter kümmerte sich um Kinder, Haus, Garten, Stall, Steuern, Geld und Buchhaltung und war froh, daß sie nicht noch den Sonntagsfußmarsch zu Wahl und Abstimmung gehen mußte. Die Politik sollten die Männer allein auf die Reihe kriegen; Armee und Politik waren in Nidwalden patriarchal – das Leben funktionales Matriarchat. Hunger gab es nicht, wir hatten ein Dach über dem Kopf, und die Küche war im Winter geheizt. Der Älteste wird Haus und Hof bekommen, ein Kind gehörte der Kirche, und es mußte irgendwie gehen, daß der Jüngste studieren konnte.
Sie begannen nicht als Photograph, sondern als Bäcker?
Nicht als Bäcker, sondern als Konditor. Üppige Hochzeitstorten waren meine Spezialität. Anders als heute fühlte ich mich dabei als Künstler. Das war in La Chaux-de-Fonds im Neuenburger Jura, um Französisch zu lernen; dieser Austausch über die Sprachgrenze in jungen Jahren war gute eidgenössische Tugend. Wenn man morgens um vier in der Backstube steht und mit den Hühnern schlafen geht, hält sich der Sprachkontakt indes in Grenzen. Bald bekam ich eine Mehlstauballergie, mußte in der Konditorei aufhören und beschloß, in den Belgisch-Kongo auszuwandern. Dann wären die Gesichter auf meinen Photographien heute nicht so bleich.
Mein Vater wollte vom bereits gepackten Überseekoffer für den Belgisch-Kongo nichts wissen und meldete mich kraft seines Amtes bei der Kantonspolizei Nidwalden an. Es gab Bewerber, die weit besser qualifiziert waren, aber Vater Arnold Odermatt, der Kantonsförster, setzte durch, daß Französisch-bis-sieben-zählen-können das entscheidende Kriterium für einen Polizisten sei, und ich wurde gewählt. Etwas Afrika hatten wir auch in Nidwalden.
Wie fingen Sie bei der Polizei an?
Mit Fahrrad, Photokamera, Schreibmaschine und Handschellen aus zweiter Hand. Die Polizei besaß damals nichts. Als junger Polizist mußte ich mich selbst ausrüsten. Nur eine Uniform in Einheitsgröße stand zur Verfügung. Straftäter wurden zu Fuß oder auf dem Fahrrad verfolgt. Gut, außer Wilderei und Verstöße gegen die behördliche Sperrstunde in der Dorfkneipe gab es kaum Verbrechen zu ahnden. Dafür sehr viele Autounfälle, verursacht durch die ganz wenigen Autos im Kanton Nidwalden. Alkohol, kein Tempolimit und kurzluntiges Bauerntemperament waren die Hauptursache. Da Autos damals so stabil waren wie Pappe oder Sperrholz und es keine Sicherheitsgurte gab, war der Blutzoll, auch bei Bagatellschäden, hoch. Weil die meisten Autounfälle für die Fahrgäste an der Windschutzscheibe endeten. Dort endete oft nicht nur die Fahrt.
Anfangs hatte ich als Polizist kein eigenes Bureau und nutze den Platz, der gerade frei war – oft zugestapelt, daß es ein Stehplatz blieb. Die Polizeinotrufnummer wurde nach Dienstschluß an meinen Privatanschluß umgeleitet. Hätte das Telephon nicht jede Nacht über meinem Bett geklingelt, müßten sich mehrere Söhne über den Nachlaß einigen.
War es seltsam, als Polizist zu photographieren?
Seltsam ist, wie wenig seltsam mir mein damaliges Treiben mit der Kamera vorkam. Ich entdeckte schnell, daß die besten Aufnahmen der Autounfälle entstanden, wenn ich aufsichtig von oben photographierte. Aufsicht brachte Übersicht. Niemand hinderte mich daran, den VW-Bus mitten auf die Autobahn zu stellen, mit Stativ und Kamera aufs Dach zu klettern und die Autobahn für die perfekte Aufnahme eine Stunde zu sperren. Notfalls auch die unfallfreie Gegenfahrbahn, wenn dies die bessere Perspektive und ein leeres Bild versprach. Niemand hinderte mich daran, mitten in der Nacht beim Nachbarhaus zu klingeln, in Socken auf das Bett der Hausherrin zu steigen und die Karambolage vom Schlafzimmer der Dachmansarde aufsichtig zu photographieren. Niemand hinderte mich, Baukräne zu entern, in luftiger Höhe den Ausleger hinauszurobben und den alle Fragen beantwortenden Topshot des Autounfalls zu photographieren. Schließlich trug ich die Dienstuniform der Kantonspolizei Nidwalden.
Die Nachsicht fand ihre Grenzen, als ich für einen am Seeufer gestrandeten Volkswagen die Uniformhose hochkrempelte, ins Wasser watete und die Aufnahme vom See her machte. Mein Vorgesetzter hätte statt meiner haarigen, nackten Beamtenbeine lieber gesehen, wenn ich für die Aufnahme per amtlichen Funkspruch einen Lastkahn mit sieben Mann Besatzung herbeordert hätte. Aus dem Rotzloch, so heißt ein Ortsteil mit Hafen in Ennetmoos, damals mit Tanzcafé und Damenwahl – ich habe meine Frau aber nicht im Rotzloch kennengelernt.
Sie waren der erste Schweizer Polizeiphotograph?
Ich dachte immer, ich sei der einzige – und die Polizisten in den anderen Kantonen müßten bleistiftzeichnen und tuschemalen. In Nidwalden versuchte ich, nicht der einzige zu bleiben und meine Kollegen auszubilden. Talent und Interesse waren überschaubar.
Als ich später Oberleutnant, Chef der Verkehrspolizei und Vizekommandant der Kantonspolizei war, hatte der kleine Kanton Nidwalden die Nerven, mich als einzigen Nichtakademiker an die Schweizerische Konferenz der Verkehrspolizeichefs zu delegieren. Als ich, der Mann der Praxis, in langen Sitzungen zur Sicherheit im Straßenverkehr den statistik- und expertisebewaffneten, akademisch gebildeten Verkehrspolizeichefs der anderen Kantone schilderte, wie es sich anfühle, allnächtlich Autounfalleichen vom Asphalt zu kratzen und die Schilderungen mit Schwarzweißphotos aus Nidwalden dokumentierte, war deren universitäres Wohlbehagen bald weidlich erschüttert, so daß sie meinen Forderungen nach strengeren Tempo- und Promillelimits willig zustimmten.
Später waren sich mein Sohn, der Herausgeber, genauso mein Berliner Galerist und der Göttinger Verleger einig: Meine Photos seien eigen und unverwechselbar, weil sie von einem bockigen – das Wort „stur“ fiel nicht – Beamten hinter den sieben Bergen und ohne jeden Einfluß, von wem auch immer, gemacht wurden.
Wie reagierten die Nidwaldner auf das Photographieren?
Gar nicht. Es hat niemanden interessiert. Gut, es kann sein, daß ich allen auf den Wecker ging, weil ich mich ausschließlich für das Photographieren interessierte. Polizeiarbeit und meine Photoarbeit – andere Gesprächsthemen gab es für mich nicht. Aber, wie mein Sohn sagt, Lob ist in Nidwalden nicht endemisch. Meine Photos waren einfach da. Wenn’s paßte, nutzte man sie. Nicht zu knapp. Wenn nicht, dann nicht. Worte verloren, hat man deswegen keine. Wahrscheinlich war’s die vertraute Art der Wertschätzung – schlechte Qualität nutzte der Nidwaldner nicht. Aber meine Leidenschaft und meine Lust nach Austausch hungerten. Später, in Chicago, in Venedig, in Krakau – dort war ich ein Star. Zuhause war ich der Noldi, der die Föteli gratis macht. Mein Sohn haßt den Rufnamen Noldi und nannte mich lange als einziger Arnold, weil Noldi für ihn für all das steht, wovon er aus Nidwalden fortlief.
Jetzt ist alles anders. Jetzt sprechen mich hier viele Leute an, die ich nicht einmal vom Sehen kenne, loben mich, laden mich ein, wollen mit mir gesehen werden, machen Dingens – Selfies! –, fragen, warum ich alles mit den Deutschen mache und versichern, schon immer gewußt zu haben, daß diese Photos einmal berühmt werden. Das Nidwaldner Museum kuratierte eine schöne, große Einzelausstellung und kaufte viele Abzüge in die Kunstsammlung an. Allerdings erst viel später, nachdem ein Zürcher die Leitung des Hauses übernommen hatte.
Was waren die Schwierigkeiten am Anfang?
Ich gewann als Zehnjähriger eine Boxkamera bei einem Wettbewerb der Zürcher Seifen- und Waschmittelfabrik Steinfels und wußte nichts. Meinen ersten Film nahm ich nach drei Aufnahmen aus der Kamera und hielt ihn gegen die Sonne, neugierig, ob schon etwas zu sehen sei. Fehlanzeige, war wohl zu früh – Chemie und Wunder brauchten Zeit. Ich rollte den Film wieder in die Boxkamera, hielt als kluges Kind die Hand satt vor die Kameraoptik und drückte dreimal den Auslöser, damit die ersten drei Photos nicht zwei verschiedene Motive übereinander zeigten. Der aus Basel zugezogene Stanser Dorfphotograph kam später aus der Dunkelkammer und meinte, Bübchen, so einen schwarzen Film hätte er noch nie gesehen. Er schenkte mir einen neuen Film und ein paar Ratschläge.
Später bei der Kantonspolizei Nidwalden waren die Probleme komplexer: ein Verkehrsunfall, nachts, außerorts, bei Regen, kein Strom weit und breit, aber bitte achtzig Meter Schärfentiefe, damit die ganze Unfallsituation amtlich und scharf zu erkennen sei. Ein paar Telephongespräche mit Fernvorwahl, die damals ein Vermögen kosteten, brachten mich auf Magnesium. Für die ersten Versuche schüttete ich das Blitzlichtpulver auf die Innenseite der Radkappe meines DKW 3=6 und malte so im Bildmotiv selbst jedes Detail mit grell leuchtendem Magnesium nach, bis alles hell war. Querwärts, nicht längswärts, damit ich in der Langzeitbelichtung nicht auf dem Negativ zeichnete – soviel hatte mich die Pike schon gelehrt. Am Schluß kam die Radkappe wieder an den Reifen. Fertig!
Mit welcher Kamera arbeiteten Sie?
Ich photographierte eine ganze Weile mit einer einfachen Boxkamera aus Pappe oder Bakelit, die schneller kaputt war als der Film voll. Aus dieser Zeit stammt wohl mein Streben nach stabil und unkaputtbar über alles. Die Boxkameras waren Billigteile mit einlinsigen Objektiven und langen Verschlußzeiten, die mit 4,99 DM beim Händler angeschrieben waren, obwohl wir in der Schweiz weder Mark- noch Pfennigpreise kannten, und sie lieferten flaue, unscharfe Bilder. Die zweiäugige Rolleiflex 3.5, die ich mir Anfang der fünfziger Jahre leistete, war das absolute Gegenteil. Sie war unverwüstlich wie ein Land-Rover und kostete, was ich bei der Nidwaldner Kantonspolizei in zwei Monaten verdiente. Sie hatte, wie schon die Boxkamera, Mittelformat – nach meiner unsentimentalen Beamtenlogik versprach das größere Negativformat die detailgenauere Vergrößerung. Ein Rollfilm hatte nur zwölf Aufnahmen; da ich aus Gründen der Sparsamkeit von jedem Motiv nur eine Aufnahme machte, schien mir weniger mehr – und übersichtlicher für meine ortschaftsortierte Einzelbildnegativablage als die sechsunddreißig Aufnahmen eines Kleinbildfilms. Und die Rolleiflex 3.5 hatte keine Wechselobjektive – das entsprach meiner Art, zu reduzieren, was geht, und erst das Bild zu denken, bevor ich die Kamera auf das Stativ baute.
Als sich in den späten sechziger Jahren die Aufgabe stellte, von den Dienstmotiven sowohl ein Schwarzweißbild für Richter und Lokalpresse, als auch ein Farbbild für das Anwerben von jungen Polizisten zu machen, habe ich die Rolleiflex SL 66 entdeckt. Sie hatte zwei Magazine für Rollfilme, eines für Farbe, eines für Schwarzweiß – erfunden für mich: ich mußte nicht mehr zwei Kameras und zwei Stative durch Nidwalden schleppen.
Die Wahl der Kamera war entscheidend?
Ja, ich arbeitete sehr lange für den Erwerb einer Rolleiflex 3.5, später einer baugleichen, aber lichtstärkeren Rolleiflex 2.8, sie paßte perfekt zu mir, sie sollte ewig halten. Jedem Handwerker, der sein perfektes Werkzeug fand, ist dieses perfekte Werkzeug wichtig. Nein, die Kamera war ein Dienstgerät und nicht mein Augapfel; nicht jeder Kratzer, nicht jeder Schmutzspritzer, nicht jeder Fettfinger oder Blutfleck, den die Kamera im Einsatz abbekam, warf mich in eine Krise.
Die beiden Rolleiflex waren keine Etepetete-Hasselblads, sie arbeiteten bei jedem Wetter und dienten der Polizeiarbeit, bei der es oft schnell und zackig ging und bei der auch Rekrutenburschenhände zupackten. Für das Schließen des Objektivdeckels mußte aber immer Zeit sein, sonst konnte ich lauter werden als das Martinshorn.
Besitzen Sie die Kamera noch?
Die Rolleiflex SL 66 war bis vor drei Jahren im Einsatz, jetzt kann ich nicht mehr photographieren, meine Sehkraft ließ wegen einer degenerativen Netzhauterkrankung nach. Zum Glück einigermaßen stabil, ich bekomme alle sechs Wochen furchtbar teure Spritzen ins Auge, die fast so sehr Gewissensbisse wie Schmerz bereiten, aber mein Sohn rechnete mir vor, ich könne – da ich nie krank war und ein Beamtenleben lang einzahlte – die Spritzen bis ins Alter von hundertvierzehn machen lassen, ohne daß die Krankenkasse, das Gemeinwesen, drauflege. Das beruhigte mich – wenn also jemand Stativ, Kamera, Objektive und den Photographen zum Motiv trägt und die Schärfe scharf zieht, kann ich gern noch einmal den Auslöser für Nidwalden drücken.
Die Rolleiflex 2.8 habe ich ausgemustert und meinem Sohn vererbt. Der arbeitete mit ihr lange weiter, übernahm meinen Zelluloidgeiz und meine Strenge. Von der Deutschen Presse-Agentur kam einmal der Auftrag, nach Klosters in den Kanton Graubünden zu fahren, Königin Silvia von Schweden exklusiv mit ihrem Kind im Skiurlaub zu photographieren und den Film per Taxikurier nach Frankfurt am Main zu schicken. Mein Sohn machte das bestellte eine Bild („Ein Bild war bestellt, nicht Bilder!“) und ließ den Rollfilm ansonsten leer dem dpa-Labor ausliefern. Von den erbleichten Gesichtern der Photoredakteure beim Sichten des zu elf Zwölfteln leeren Filmstreifens gibt es leider keine Aufnahme, dafür Belegexemplare des einen Bilds aus Klosters in Zeitungen von Ecuador bis Taiwan.
Sie entwickelten die Photos selbst?
Nach Feierabend und am Wochenende im ehelichen Badezimmer. Meine Gattin ließ sich deswegen nicht scheiden. Unsere Generation sah solche Übergriffe gelassener. Mein Sohn warf mir später vor, das erste, was er von Photographie wußte, sei, daß sie stinke. Später bewilligte der Kanton Nidwalden das Budget für einen Wasseranschluß in einer Besenkammer des Polizeibureaus; in der Folge konnte ich mein privates Durst-Vergrößerungsgerät aus dem Südtirol und meine Chemiesammlung in den Staatsdienst stellen. Ich bin absoluter Autodidakt und brachte mir die Laborarbeit durch Versuchen, Schätzen und Fehlermachen selbst bei. Es gab niemanden, den ich hätte fragen können, und zu lesen gab es nur, was auf Verpackung und Beipackzettel stand. Verstanden habe ich davon meistens nur Bahnhof. Also: Ausprobieren!
Viele Jahre später wollte Jasmin Morgan, Filmproduzentin und Partnerin meines Sohns, wissen, was das Künstlergeheimnis sei, wenn ich im Labor Photos vergrößerte. Ich merkte: Keine Ahnung. Ich probiere aus, weiß, was geht, was nicht, was vielleicht, wo abwedeln, ungefähr bis jetzt, mhm – noch etwas, gut. Aber erklären? Gar unterrichten? Fehlanzeige. Wissen weiß nur meine Erfahrung – Reflexe und Bauch helfen aus. Ich war erst besorgt, als der Berliner Galerist handabgezogene Editionen meiner Photos anbieten wollte. Acht plus drei gleichaussehende Prints – wie soll mir Amateur ohne Lehrzeit und Lehrbuch dies gelingen? Robert Springer beruhigte mich bei der Ablieferung der ersten Edition. Alles Unikate, eindeutig, sogar der vergessene Krümel von der Künstlerstulle hatte für ihn den Charme des Authentischen. Mein Sohn war viel strenger und sorgte in der Folge dafür, daß nur noch das beste nach Berlin kam.
Wurden die Photos damals veröffentlicht?
Ja, vor allem in der Lokalpresse, wenn der Autounfall oder das Sommerloch groß genug waren. Meist ohne Budget, da Polizisten ohnehin Staatskosten kosten und – je nach Tagesform des Layouters – im Quer- oder im Hochformat, aber nie im Originalformat der Rolleiflex, quadratisch. Ich fing an, selbst im Labor einen Abzug in Quer- und einen in Hochformat als Vorlage zu vergrößern, auch wenn ich an der Kamera die Aufnahme quadratisch gestaltete. Doch meine Ausschnitte waren für die Lokalpresse eine Art Entwurf; kaum ein Layouter hielt sich daran. Diese Freiheiten konnte ich mir beim Bußgeldbescheid nicht nehmen; die Tarife des Gesetzgebers waren Festpreise.
Gelegentlich hatte ich das zweifelhafte Glück, daß die Fahrzeuge der Autounfälle ausländische Kennzeichen trugen – das besonders schreckliche Schicksal eines amerikanischen Touristenbusses, dessen Chauffeur seine Fahrgäste in die Tiefen des Vierwaldstättersees fuhr, brachte meine Photos bis in den San Francisco Chronicle. Noch häufiger als die Photos wurde mein Licht veröffentlicht, vor allem nachts, bei Regen, außerorts. Kaum strahlte mein Magnesium für dreißig Sekunden hell über dem Himmel des Autounfalls, drückten ganze Einheiten von Presseleuten auf den Auslöser. Aber: Nur ich stand auf dem Dach des VW-Busses, aufsichtig mittig über der Sachlage. Der Frechste unter den Reportern verzieh mir erst an der Ausstellung in der Zürcher Photobastei, daß ich ihn von Amtes wegen nie aufs Dach klettern ließ.
Sahen Sie sich mehr als Polizisten oder als Photographen?
Ich war immer ein Polizist, der die Aufgabe hatte, den Tatbestand bildlich festzuhalten, als Angehöriger der Verkehrspolizei in der Regel Verkehrsunfälle. Mit dem tauglichsten Werkzeug, das mir zur Verfügung stand: der Photographie. Ein gutes Bild muß scharf sein und alle Details klar festhalten, vom Vordergrund bis zum Hintergrund, bei jedem Wetter, bei jeder Tages- und Nachtzeit. Ein gutes Bild muß sich streng von allem trennen, was nicht zum Sachverhalt gehört, und es muß einen Kamerastandpunkt haben, der dem Betrachter hilft, zur Sache zu kommen: aufsichtig, symmetrisch, frontal, mit klaren Bezügen statt Perspektiven, die irgendwo im Nirwana landen. Daß aus diesem von mir erwarteten Handwerk eine eigene Handschrift wurde, liegt daran, daß ich nichts wußte, keinen fragen konnte und alles selbst herausfinden mußte. Mit dem Druck des Geldbeutels, jeden Fehler nur einmal zu machen. Daß aus der Handschrift später Kunst wurde, dafür kann ich nichts; es ist das Werk der Zeitläufte – ähnlich wie bei uns in Nidwalden dorfbekannt sture und bockige Zeitgenossen im Nachruf konsequent und gradlinig sind.
Mitte der sechziger Jahre hatte ich die Aufgabe, in den Schulen junge Burschen für den Polizeidienst anzuwerben. Es war eine wilde Zeit; die Jugend wollte gegen die Polizei rabatzen, demonstrieren und lange Weiberfrisuren tragen, aber nicht in Uniform und Bürstenschnitt für Ruhe und Ordnung sorgen. Die Nidwaldner Kantonspolizei verlangte eine abgeschlossene Berufslehre, damit die jungen Polizisten nicht allzu jung, sondern etwas im Leben geerdet waren. Abgebrochene Mittelschuljahre, Lehrzeiten in bewußtseinserweiternden Plantagen und kreative Südamerikareisen mit Gitarre und Rucksack haben die Polizei bei der Musterung nicht interessiert. Ich bereitete Lichtbildvorträge für die Grundschule vor, um der Schuljugend zu zeigen, was die Polizei Großartiges hatte und konnte: Autos mit Blaulicht, Motorboote, Motorräder, ordentliche Waffen, Funkgeräte, Radar, gnadenlose Reifenkrallen. Am meisten interessierte die Dorfjugend die Sperrungen. Die Macht, zu sperren, fanden einige ganz toll. Jahre später feierten sie ihre bestandene Matura mit einer Phantombaustelle auf der Autobahn und sperrten eine Fahrspur. Das fand die Polizei nicht wirklich toll. Ein paar nette Polizeirekruten lockten die Lichtbildvorträge immerhin an.
Wie war der Alltag?
Es war nicht nur Alltag, sondern auch Allnacht. Jede Nacht. Ich besaß kein eigenes Bureau, ich war der „Gang-go!“, der Geh-mal! der Nidwaldner Kantonspolizei und für alles zuständig, was die Kollegen nicht aus dem angewärmten Stuhl erledigen konnten. Das einzige, das ich anwärmen konnte, war der Sattel meines Fahrrads, da nicht alle der elf Gemeinden Nidwaldens im Talgrund lagen. Gangschaltung und Bremse hatte das Fahrrad nicht, dafür Rücktritt, um das Hinterrad zu blockieren. Wenn die Kette riß oder vom Ritzel sprang, war die Rücktrittbremse funktionsunfähig. Dann gute Nacht, Alltag.
Später – als Chef der Nidwaldner Verkehrspolizei – versuchte ich, ein paar Fehler zu vermeiden, die ich in meiner Anfängerzeit miterlebte: Ich sorgte dafür, daß die Autofahrer bei der Verkehrskontrolle nicht geduzt wurden, auch wenn sie außerdienstlich unsere Nachbarn waren. Einige der jungen Polizeikollegen gingen dem Du und dem Sie aus dem Weg und flüchteten sich ins Ärzte-Wir. Das konnte schiefgehen, wenn der kontrollierte Autofahrer ein frecher Zürcher war. Nidwaldner Polizist: „Haben wir etwas getrunken?“ – Zürcher: „Ich nicht!“
Sie dokumentierten das Leben der Nidwaldner in Nidwalden?
Dahinter steckte kein Entschluß, sondern die Tatsache, daß der Nidwaldner immer wußte, wo der Geldbeutel saß. Wenn in einem der elf Dörfer eine neue Kuh, ein neuer Stall, eine neue Frau oder ein neuer Reisepaß anstand, sparte der Nidwaldner gern die Rechnung des Dorfphotographen und rief bei Noldi an, da dieser schon qua Steuerbescheids bezahlt war und es so in einem Aufwasch ging. Außerdem bekam ich mitgeteilt, daß die Photographie mein Hobby sei und man mir eine Freude bereiten wolle.
Über die Jahre führte diese bodenständig haushälterische Wirtschaftsführung dazu, daß in Nidwalden nichts ohne meine photographische Dokumentierung blieb. Ich gebe zu, das Eingestehen der künstlerischen Absichtslosigkeit und die achtzig Jahre Zufall in der Motivwahl widerstreben meinem trotzigen Wunschdenken, schon immer gewußt zu haben, daß meine Photographien einmal berühmt werden. Oder? Aber ohne die hiesige Nidwaldner Bockigkeit und mein beharrliches Tüfteln wäre aus mir Urschweizer Grind wohl „nie kein Künstler“ geworden.
Wenn Sie auf die vierzig Jahre als Polizist zurückblicken, was gefiel Ihnen am Beruf, was nicht?
Ich sah viel Schlimmes in den vierzig Jahren, und hinter fast allem Schlimmen stand Alkohol. Ich wurde ein ziemlicher Fanatiker und trinke meist nur Tee und Wasser. Muß ich bei unausweichlichen Gelegenheiten mit Wein anstoßen, landet die zweite Hälfte des Glases im Blumentopf des Gastgebers. Mein Feierabendbier ist ein dreifach verdünntes Radler. Meinem Sohn hätte ich einen Banküberfall verziehen – das kann ja mal passieren –, aber niemals Alkohol am Steuer. Ich hasse Alkohol. Ich hasse ihn, weil ich zu viele Leichen gesehen habe. Bei der Polizei gefällt mir der Fortschritt: Anfang der fünfziger Jahre hatten wir in Nidwalden ein paar Dutzend Autos mit ein paar Dutzend Verkehrstoten jedes Jahr. Heute haben wir in Nidwalden ein paar Zehntausend Fahrzeuge und oft viele Jahre nicht einen einzigen Verkehrstoten. Ich liebe diesen Fortschritt.
Die Leichen bei den Autounfällen waren nicht das schlimmste, das schlimmste war das Klingeln an der Haustür: Ihr Mann ist tot, Ihre Frau ist tot, Ihr Kind ist tot. Einmal im Monat, ein Berufsleben lang. Die Toten waren tot – es waren die Augen der Angehörigen, die mich verfolgten. Die Polizisten von heute sind Glückspilze, ihnen geschieht das vielleicht einmal im Leben. Dann gibt’s Unterstützung durch nette Polizeipsychologinnen. Ich hatte nur den Haß auf Alkohol. Und die Konzentration auf die Photographie – fürs Amt und den Richter: scharf, genügend Licht für große Schärfentiefe, auch nachts bei Regen, die Reduktion auf das Wesentliche.
Würden Sie heute andere Motive photographieren?
Nein, warum?
Hätte die digitale Technik Ihre Arbeit verändert?
Ich schraube nicht mehr Schrauben in die Wand, nur weil es jetzt Elektroschrauber gibt. Beides geht natürlich schneller, Elektroschrauben und Digitalphotographieren. Aber ein Bild ist ein Bild, es gibt nur zwei Kategorien: gute und schlechte. Der Unterschied ist Handschrift und Handwerk des Photographen geschuldet, seinem Auge, dem Gespür für die bildliche Komposition, dem Gespür für den einzig richtigen Moment, seinem Timing für diesen Moment. Der Photograph muß den einzig richtigen Moment spüren, bevor er da ist, sonst ist er weg, bis der Entschluß vom Gehirn den Weg zum Auslöserfinger schafft. Der einzig richtige Moment ist auch in der neuen digitalen Technik analog. Timing ist zeitlos; nicht der schnellste freit die schönste Tochter, sondern der richtige Augenblick. Für mich war der finanzielle Druck, von jedem Ereignis nur ein einziges Bild zu machen und die Zeit zu fordern, bis es paßt, der Königsweg.
Doch um eines beneide ich die Kollegen der digitalen Generation: um das stets zur Verfügung stehende Polaroidbild – auf dem Kameramonitor, gratis und franko. Ich weiß nicht, ob meine Photos besser geworden wären, wenn ich Komposition und Licht vor jeder Aufnahme hätte prüfen können; Nerven, Geduld, Laune und letztlich meine Ehe hätte es indes geschont, weil erst die Entwicklung im Badezimmer die Gewißheit brachte, daß die analoge Aufnahme glückte. Natürlich gab es damals Polaroidmagazine bei Hasselblad-Kameras; aber das war eine andere Liga – bei meinem Beamtengehalt wäre schnell Ebbe gewesen.
Wie denken Sie über die digitale Zeit?
Auch wenn die Antwort überrascht: Ich bin absolut begeistert! In den Jahren 1959 bis 1964 hielt ich den Bau der ersten Schweizer Autobahn auf einer zerschrammten Gebrauchtfilmkamera fest. Es war eine stumme Paillard-Bolex-16mm-Kamera mit Federwerk, Handkurbel, abgeschnittenem Revolver für drei Objektive und Platz für eine Dreißig-Meter-Spule. Da Geld knapp war, kam stets Schwarzweißrohmaterial in die Kamera, das im Sparangebot feil war, neben teurem Kodak und Agfa oft Ilford, Perutz, Orwo oder 3M. Für eine ordentliche Negativentwicklung mit Positivkopien fehlte das Budget; ich ließ das Material im Labor umkehrentwickeln, klebte alle Filmenden zusammen und spielte das einzige Original über Jahre in Baustellenkantinen und bei Betriebsfesten ab. Da die Projektoren der Bauleute schlecht gewartet waren und mit dem häufigen Wechseln der Dreißig-Meter-Filmspulen beim Drehen auf der Baustelle oft Staubkörner mitgewechselt wurden, war das Material Jahrzehnte später letal zerkratzter Sondermüll und zur Entsorgung bestimmt.
Mein Sohn hat im letzten Augenblick alles im Speicher entkrempelt und entrümpelt. Er montierte das verstreute Filmmaterial mit einem Schnittmeister ordentlich zu einem Dokumentarfilm, nannte dieses neuentstandene, aber völlig versehrte und unspielbare Werk Lopper und deponierte es in der Cinémathèque suisse. Seine Partnerin Jasmin Morgan lieh die unikaten Filmrollen vor ein paar Jahren in Penthaz aus und restaurierte den sorgfältig digitalisierten Film mit dem Münchner Filmrestaurateur Thomas Bakels. Das Resultat ist einfach nur phantastisch und besser, als das Original jemals war. Die digitale Revolution rettete mein analoges Nidwaldner Zelluloidgedächtnis.
Sie arbeiteten später neben schwarzweiß auch in Farbe. Wie war der Umstieg?
Unfreiwillig. Erst mußte ich im Urlaub bei den Schwiegereltern im Tessin ab und zu ein Farbphoto der Familie machen – meine Gattin fand, die Welt sei farbig und nicht schwarzweiß –, alsdann wollte mein Vorgesetzter eines Tages, daß ich in der Schule Fahrrad- und Verkehrsunterricht erteile und prächtige Farbdiapositive der Polizeiarbeit zeige, damit die Sicherheit im Straßenverkehr größer und die Nachwuchsprobleme des Nidwaldner Polizeikorps kleiner werden. Der Kommandant trieb einen stämmigen Mittelformatdiaprojektor aus Gußstahl in alten Militärbeständen auf, dessen Einzelbildschieber mehr Kraft forderte als ein Lastwagensteuerrad. Bei den Schwarzweißaufnahmen kam stets nur Rückmeldung, wenn eine Sicht oder ein Detail fehlte, sonst war alles selbstverständlich. Die Farbaufnahmen fanden plötzlich alle bunt und toll! Aber rot und blau war vor der Aufnahme schon rot und blau – die neue Wertschätzung galt Kodak und Agfa, nicht dem Photographen.
Einige meiner Polizeidias nutzte ein Grundschullehrer für den eigenen Verkehrsunterricht. Entweder war dem Mann das Mittelformat unbekannt, oder er sah den Nutzen von Gußstahl statt Bakelit bei einem Diaprojektor nicht ein – er zerkleinerte meine 6/6-Originaldias zu 4/4-Dias, damit sie in den tattrigen Kleinbildprojektor der Schule paßten. Mit der Schere! Körperstrafe kannte die Nidwaldner Polizei damals leider nicht mehr.
Sehen Sie Ihre Arbeit als Dokumentarphotographie?
Das hab’ ich mir nie überlegt. Ich schoß die Photos so, wie ich dachte, daß sie gebraucht werden. Wenn sie gebraucht werden. Die meisten Photos – vor allem die Karambolagen – zog ich nie im Labor ab, sondern legte sie als Negative ins Archiv. Außer, der Richter, das Protokoll, eine Versicherung oder die Lokalpresse fragten danach. Dann sollten die Photos so sein, daß keine Frage offenblieb. Gebrauchsphotographie nach bestem Handwerk. Sachphotographie kommt der Sache näher als Dokumentarphotographie. Entstanden ohne Handbuch, Einfluß und Vorbild, leider, ein unfreiwilliger Autodidakt in Nidwalden.
Als ich im Ruhestand mit meinem Sohn die eine oder andere Kunsthalle besuchte, merkte ich, daß die Arbeit in dieser der Not geschuldeten Selbstbestimmung die Konzentration auf den eigenen Weg lehrte, weniger die Neugier auf andere Wege. So richtete sich mein Blick auf Photographen, bei denen ich eine retrospektive Augenverwandschaft sah, Photographen, die ähnlich die Welt in den Photos entrümpelten (Ist das nicht das Gegenteil von Dokumentarphotographie?) und – aufs Wesentliche konzentriert – Personen, Sachen oder Sachverhalte photographierten. Etwa Peter Keetman die Sache Volkswagen, Rineke Dijykstra die Sache Pubertät, Michael Kenna die Sache Landschaft. Es gibt bestimmt viele, die ähnlich arbeiten; diese drei blieben in meiner Erinnerung – ich bin Polizist, kein Kunstmensch.
Wählten Sie die Bildsprache bewußt nüchtern?
Ich war Beamter und diente mit den Unfallphotos dem Protokoll und dem Richter. Da zählten nur Fakten. Dekoration störte, lenkte von den Fakten ab. Diese Tatsache war nicht einfach zu akzeptieren im isolierten, engen Nidwalden, das damals nur mit dem Schiff oder über eine Drehbrücke zu erreichen war und wo man genau zwei Menschenrassen kannte: Wir von hier, und die anderen von woanders. Alles, was im Kanton etwas größer, schöner, schneller oder besser war, war – mangels Vergleichsmöglichkeit – sofort weltgrößtes, weltschönstes, weltschnellstes und weltbestes. Diese gestörte Weltniveauselbsteinschätzung zeigt, wie ähnlich sich geschlossene Gesellschaften sind, egal, ob sie sich katholisch oder kommunistisch definieren.
In den Anfangsjahren hatte ich nichts außer der Rolleiflex und Negativfilm für eine Aufnahme pro Ereignis. Geiz war schlicht und einfach Überlebenshilfe. Welcher Teufel mich ritt, daß ich die Schande der Mittellosigkeit nicht mit Zeug, Dingen und Krempel zutünchte, sondern – auch bei den zivilen Photos – mit Reduktion, Leere und Formstrenge aus der Not eine Tugend machte, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, daß das endlose Verzögern der Aufnahme, diese Performance in Uniform – ich räumte erst kompromißlos alles Überflüssige und Unwichtige aus dem Bild; später ließ ich unter amtlichem Herumkommandieren vom Dach des VW-Busses die Polizeikollegen alles aus dem Bild räumen –, mir damals ein Netto in der Währung Aufmerksamkeit brachte, die den fertigen Photos in Nidwalden fehlte.
Kam nie der Gedanke, daß Ihre Photos einen künstlerischen Weg gehen?
Weder mir, noch sonst wem. Kunst waren in Nidwalden die nackten Barockengel in der Pfarrkirche und die schwere Orgelmusik auf der Empore. Kunst gehörte in große Gebäude, wie ich sie beim Schweizerischen Landesmuseum in Zürich vom Hörensagen und beim Kunstmuseum Luzern von außen kannte. Große Gebäude definierten unseren Kunstbegriff. Meine Photos hatten – wenn die Wertschätzung hoch sein sollte – die Relevanz eines Jodlerchors, einer Jaßrunde oder eines Karnevalwagens am Fasnachtsumzug.
Wenn ich auf dem Dach des VW-Busses stand, allein über Rolleiflex und Kamerastativ, war mir klar, daß ich selbstbestimmt – schöpferisch, vielleicht wie ein Pfeifenschnitzer – das Bild gestaltete, daß ich wußte, was ich suchte, ohne daß ich es beschreiben konnte. Ich war sicher, wann der Moment für den Auslöser da war und hätte mir an der Kamera von niemandem reinreden lassen. Im Photolabor war es völlig anders: Niemand wollte Bilder in quadratischem Format. Ich machte aus den freien Negativen unfreie Gebrauchsphotos und vergrößerte sie gemäß Bestellung im Hoch- oder Querformat. Natürlich machte mein ehrgeiziges Auge nicht Feierabend, bis auch diese nach Ansage beschnittenen Bilder anständige Ausschnitte hatten.
Gab es Gespräche über Ihre Arbeit als Photograph?
Nein, die Photos waren recht, wenn’s paßte. Gespräche über Photos, Gespräche über deren Entstehen – Wie? Wo? Wann? – haben in Nidwalden keinen interessiert. Nicht einmal meinen Sohn, der als Jugendlicher lieber nächtelang die Dorfbibliothek leerlas und sich in den Lesepausen mit den Dorfmädels herumtrieb, als mir in der Dunkelkammer zur Hand zu gehen. Wohl meine Schuld – im Labor war ich unausstehlich, wenn ich nicht allein war. Für das Entwickeln und Vergrößern seiner eigenen Photos war ich gut genug – Ursens Blick auf Kontraste und Ausschnitte war indes so eisern, daß mir das nicht unzufriedene Schweigen des Richters lieber war.
Es war mir ganz recht, daß ich mit niemandem über die Photoarbeit reden mußte – was der Bauch weiß, läßt sich schlecht erklären. Aber ein paar persönliche Komplimente zu den verschenkten Abzügen hätte ich gern gehört. Heute ist alles anders – oder auch nicht. Als ich meinen Berliner Galeristen und meinen Sohn an die Eröffnung der Einzelausstellung im Art Institute of Chicago begleitete, veranstaltete der leitende Kurator James Rondeau im Auditorium ein fünfstündiges Symposium mit Vorträgen über meine Photos. Ich zog die beste Krawatte an und bereitete ein paar englische Grußworte vor, aber nur einer der Redner erwähnte kurz, der Künstler sei im Saal anwesend und begrüßte mich, ohne mich auf die Bühne zu bitten. Mein Sohn flüsterte mir zu, das sei oberste Liga, hier ginge es um mein Werk und nicht um mich, mehr könne ein Künstler im Leben nicht erreichen. Wenn das so ist, gut, schön, noch schöner wäre gewesen, wenn ein Journalist der Nidwaldner Zeitung in Chicago dabeigewesen wäre und zuhause berichtet hätte. Wertschätzung in Nidwalden war mir wichtiger als Wertschätzung in der Welt.
Ich las, Sie trafen Werner Bischof in Nidwalden?
Ohne Werner Bischof gäbe es meine Photos nicht. Ich traf ihn in dienstlichem Einsatz Anfang der fünfziger Jahre auf dem Bürgenstock. Ein Zürcher in zivil, der wie ich – allerdings in Uniform und mit Personenschutzauftrag – Berühmtheiten vor dem Grand Hôtel photographierte. Die Zürcher Privatperson verwickelte mich jungen Polizisten in ein Gespräch, bestrebt, sich mit der Kamera in meiner Uniformnähe näher ins gesperrte Areal zu wagen, und er schärfte mir ein – wohl aus bemessener Gefälligkeit –, meine Negative nach Abzug und Niederschrift des Protokolls nicht wie Kohlepapier im Müll zu entsorgen, sondern ordentlich abzulegen, nach einem System, sie später wiederzufinden. Nicht, daß wir Nidwaldner damals auf Zürcher Ratschläge warteten, aber die Argumente des Zivilisten leuchteten ein: Ich schmiß in der Folge die Negative nicht mehr weg, sondern bewahrte – in bester Polizeimethode – jedes Negativ als Einzelbild in einem mit Ortschaft und Jahr beschrifteten, amtsgrauen Briefumschlag in Karteikästen auf.
Einer aus dem Troß der Berühmtheiten auf dem Bürgenstock verriet mir abends, daß diese Zürcher Privatperson der berühmte Photograph Werner Bischof war; ich stimmte zu und nickte, als hätte ich den Namen schon gehört. Ich merkte mir den Namen, weil ich jetzt ein Negativarchiv wie dieser Bischof hatte. Wahrscheinlich waren wir die einzigen Photographen, die Negative nach Gebrauch aufbewahrten... Die Photographien von Werner Bischof habe ich erst Jahrzehnte später gesehen.
Ihr Sohn, der Regisseur Urs Odermatt, löste Ihre Arbeiten aus dem Polizeikontext und brachte sie in Museen und Galerien. Wie kam es dazu?
Ich fragte ihn, ob wir zusammen ein Photobuch machten, und er sagte, nein, zusammen gehe nicht, entweder mache ich das Buch allein, oder ich gebe ihm alle Rechte und einen Freibrief, dann mache er ein Buch nach bestem Wissen und Können. Ich erlebte kurz vorher mit, wie er den Spielfilm Gekauftes Glück gegen alle Widerstände und alles Im-Regen-stehen-lassen durchgefochten und zum Erfolg geführt hatte, und da ich Dickköpfigkeit für eine hervorragende Nidwaldner Tugend halte, hatte ich das Vertrauen, ihm alles zu übergeben. Ich sagte: „Mach!“
Oben auf dem Stapel lagen prächtige Farbaufnahmen unserer berühmten Nidwaldner Landschaft, schöne Ortsbilder, See und Berge, dazu lustige Kinderphotos. Ich hatte eine kurzweilige Auswahl von Motiven unserer Heimat für das Buch getroffen. Ich konnte nicht ahnen, daß er bei der Recherche zu seinem Spielfilm Wachtmeister Zumbühl den Stapel mit den alten Unfallphotos im Speicher entdeckt hatte. Davon auszugehen, jemand interessiere sich für Autounfälle und Dienstphotos in Buchform – nie wäre ich auf diese Idee gekommen. Zu spät! Mein Sohn stürzte sich auf diesen alten Chabis und holte sich gleich eine blutige Nase: Der erstkontaktierte, damals sehr bekannte Luzerner Kunstbuchverleger versicherte, fast an Eides statt, daß – wenn überhaupt – allenfalls ein Autoversicherer für den Jahresbericht, aber ganz sicher „nie kein Buchverlag“ an Unfallphotos Gefallen fände. Ich sagte nichts dazu. Ich kannte die Bockigkeit meines Sohns. Später mußte ich gar die Kröte schlucken, daß ein halbnacktes Selbstauslöserschärfetestbild, das nie zum Vergrößern gedacht war und nur durch Zufall als Negativ überlebte, In zivil als Titelbild zierte. Aber: Bravo! Mein Sohn hatte recht. Ich bereue nichts. Der kleine Verlag aus Luzern gehört heute einem viel größeren Verlag, dessen Besitzer Photographie sammelt. Mehr sage ich nicht.
Machten Sie die Einteilung der Werkgruppen und die Titel der Arbeiten gemeinsam mit Ihrem Sohn?
Nein, ich steckte die Negative einzeln in graue Amtsumschläge, klebte die Umschläge zu, schnitt ein Fünftel weg und bekam oben offene Tüten. Die Tüten beschriftete ich mit Ortschaft und Jahr und sortierte sie nach diesem System in die Karteiholzkästen, in denen wir früher den eingezogenen Paß der Gastarbeiter deponierten, bis sie die Steuern bezahlt hatten. Daß dieses System das System der Bildtitel meiner Photos werden sollte, fand ich langweilig. Ich hätte als Titel geschrieben: Weißer Peugeot liegt regennaß vor Hauswand auf dem Dach! Im Zwielicht. Mein Sohn warf als Antwort das Photo in den Eimer – dann reiche der bloße Titel!
Meine Welt war das erste Buch. Es war eine Art monographischer Einstieg. Erst ein Ladenhüter – nach der ersten Ausstellung während der Frankfurter Buchmesse 1998 ein großer Erfolg über mehrere Auflagen. Die Werkgruppen heißen Karambolage, Im Dienst, In zivil und Feierabend. Die Namen sind kurz, klar, knapp und liegen so nahe bei meinem photographischen Tun, daß ich nicht sagen kann, warum ich nicht selbst darauf kam. Aber vielleicht vermag den wahren Wert des Vertrauten und des Authentischen nur die Distanz eines langen Auslandaufenthalts zu entdecken. Mein Sohn mußte nicht lange nachdenken.
Die Werkgruppe „Karambolage“ ist weltbekannt. Wie finden Sie das?
Anfangs schrecklich. Wenn mir einen Namen als Photograph schaffen, wollte ich diesen mit Bildern unserer schönen Nidwaldner Landschaft erwerben. Plötzlich sprachen alle begeistert von den Unfallphotos! Mein Sohn fragte mich enttäuschten Dickkopf, wieviele Photographen es gäbe. Es war Mitte der neunziger Jahre, und ich antwortete, daß ich niemanden kenne, der nicht photographiere. Also stelle sich die gleiche Aufgabe wie beim Schreiben, meinte er: Jeder, der sich einen Stift leisten könne, schreibe – doch, zu Recht, nur ganz weniges davon wolle jemand lesen. Das könne nicht das Problem sein, schimpfte ich, schließlich stehe hinter meinen Photos ein halbes Leben Handwerk und Erfahrung.
Mein Sohn schleppte mich in eine große Zürcher Photobuchhandlung – es hat mir die Sprache verschlagen. Ein Unmenge Werke, Platz wie in einer halben Kathedrale, bis unter die Decke gefüllt mit besten Photobüchern, alles allererster Güte, alles perfektes Handwerk, unterschiedlichste Handschriften, großartigste Landschaften und Weltsichten. Keiner der Photographen war mir vertraut – jeder ein Grund, das ganze hinzuschmeißen. Mein Sohn sagte: „Schau genau hin, schau, was hier fehlt.“ Alle Photographen seien Photographen, keiner sei Bulle. Keiner könne die Autobahn Hamburg-Rom samt Gegenfahrbahn für eine Stunde sperren und vom amtlichen VW-Bus-Dach gelassen an Kamera, Licht und Bildausschnitt schrauben, bis die Delle an der Stoßstange eines Kleinwagens ins Zwielicht gerückt und fürs Protokoll sauber festgehalten sei. „Diese Photos, dieses Thema mit Handwerk in dieser Konsequenz und die Uniformmacht des Beamten, die das zuläßt – das gibt’s noch nicht!“
Heute blättere ich jeden Tag ein paar Seiten im Karambolage-Buch. In den anderen Büchern auch, selbstverständlich, sie sind mein Leben. Aber Karambolage ist der Schlüssel. Damit hat alles angefangen. Ohne Karambolage wäre ich bloß einer von Millionen Photographen. Ich bin sehr stolz auf das Buch.
Die „Karambolage“-Werkgruppe strahlt eine große Ruhe aus. Fanden Sie die Ruhe auch beim Photographieren?
Das Photographieren hat mich abgelenkt. Keiner will wissen, was man als erster bei einem Autounfall sehen kann. Nachts, weit und breit keine Menschenseele, kein Funkgerät. Jede halbe Stunde ein Auto – der Fahrer will keinen Ärger und hält Kurs. In den frühen fünfziger Jahren, als es noch keine Sicherheitsgurte gab und Fahrer wie Mitfahrer das Fahrzeug beim Aufprall durch die Windschutzscheibe verließen, stand ich oft vor der Frage, begleite ich die letzten Lebenssekunden oder renne ich zum nächsten Bauern und frage ihn, ob er einen Telephonanschluß habe. Das Photographieren war wichtig, um Boden unter den Füßen zu haben.
Die Photographien der Karambolage-Werkgruppe wirken beruhigend? Der Gedanke gefällt mir. Er bestätigt, daß meine Arbeit einen Sinn hatte: Das Leben geht weiter.
Ihre Photographien, vor allem die Werkgruppe „Karambolage“, zeigen die Verwüstung danach. Gab es auch Aufnahmen, die „im Geschehen“ stattfanden?
„Im Geschehen“ nicht, das machen Überwachungskameras. Autounfälle führen keine Agenda und melden sich nicht an mit Dispo und Uhrzeit. Aber manchmal – wenn man sehen will – kündigen sie sich an. Situationen „vor dem Geschehen“ lichtete ich viele ab, unübersichtliche Kurven und Abzweigungen, unkrautüberwucherte Verkehrsschilder, Radfahrer, die nach dem Marktgang weder Blick noch Hände frei hatten, Schnee, Eis, regennasse Straßen mit den Blättern vom nahen Waldrand, abgefahrene Reifen, Staubwolken vom Abrieb der Spikes-Reifen, auch: ungeschickte, bevormundende, widersprüchliche oder zu viel Signalisierung – selbst wenn meine Vorgesetzten das anders sahen. Manchmal etwas abstrakter: Vor der Kneipe geparkte Autos.
Meine Photos dokumentieren die Zeitlichkeit der Polizei. Die Polizei ist bei der Straftat, beim Autounfall, in Regel nicht dabei. Sie wird später gerufen, um zu ahnden, zu deeskalieren, zu helfen. Sie versucht vorher zu regeln, zu warnen, hinzuweisen, vorzubeugen. Um nicht – wie früher oft – die Leichen vom Asphalt zu kratzen.
Der Photograph ist weithin passiver Beobachter – wie gehen Sie mit der Schaulust um?
Schaulust ist etwas Großartiges. Ohne Schaulust gäbe es keine Malerei, kein Kino, kein Theater, keine Photographie. Ohne Schaulust müßte man weder Landschaft noch Stadtbilder schützen. Die Bevölkerung nähme ohne Schaulust schnell ab – auch wenn keiner ohne Schaulust vor dem Rechner sitzt. Gaffer sind ein ganz anderes Thema. Auch wenn ich weiß, daß sich in Nidwalden damals Fuchs und Hase gute Nacht sagten und die Leute um jede Abwechslung vom drögen Alltag froh waren, auch wenn ich weiß, daß es den Leuten hilft, sich der eigenen Unversehrtheit zu versichern, wenn sie das Leid anderer sehen: Gaffer waren immer, höflich formuliert, zusätzliche Arbeit für uns. Wir mußten sperren, wir mußten die Sperrung durchsetzen, wir mußten das Durchkommen der Helfer sichern, den Sichtschutz planen, vorausdenken, auf welche Ideen die Gaffer kommen könnten – und manchmal eine zusätzliche Ambulanz bestellen, wenn ein Baumast wegen Gafferüberlastung eingebrochen ist. Und ich mußte schauen, daß ich meine Photos über den Sachverhalt ordentlich machen konnte. Gelegentlich mußte ich die Gafferreihen in die Aufnahme einbauen – einen Berg zu verschieben, schien leichter. Ich will nicht wissen, wie es heute auf dem Schauplatz eines Autounfalls aussieht, wenn jeder mit dem Telephon photographieren und die Bilder im Netz wie Briefmarken tauschen kann.
Gaffer stören die Einsatzkräfte, Gaffer verletzen Intimität und Würde der Unfallopfer. Bilder können indes warnen, berichten, festhalten, nachweisen, erklären – sie können es am besten, wenn sie sachlich, streng gebaut und aufs Wesentliche konzentriert sind. Einige Redakteure wußten das und druckten meine Photos, obwohl Presseleute vor Ort waren.
Autounfälle sind tragisch und zeigen den Tod – Ihre Photos haben Charme und Witz. Absicht oder Gunst des Schicksals?
Photos sind grundsätzlich versöhnlicher als die Wirklichkeit. Als Verkehrspolizist kannte ich diese und wußte das. Das zweidimensionale Einzelbild macht jedes Grauen erträglicher als das dreidimensionale, der gebannte Moment zähmt die entfesselte Realität. Meine in ihrer amtlichen Aufgabe – und in meiner persönlichen Handschrift – auf Ursache und Wirkung reduzierten, sachlich gestalteten Unfallphotos waren versöhnlicher als die lauten Reportagephotos der Lokaljournalisten. Selbst wenn die Reporter in meinem Magnesiumlicht und im gleichen Augenblick wie ich den Unfall photographierten. Mit dem Aussparen von allem, was nicht dazu gehörte, mit der Wahl des – meist aufsichtigen – Kamerastandpunkts und des ordentlichen, nichtablenkenden Bildausschnitts gelang eine Art Fiktion, die den Schrecken abstrahierte und sich auf den Sachverhalt fokussierte.
Autounfälle waren nie lustig. Ich erspare dem Leser die Details. Was die Zeitläufte freilich mit dem Grauen von gestern anstellen, ist eine spannende und unerwartete Erfahrung. In den Ausstellungen in Ländern mit ganz unterschiedlicher Mentalität konnte ich immer mit den Besuchern über die Karambolage-Photos lachen und albern. Zeitlich versetzte Schadenfreude ist ansteckend und befreiend. Schadenfreude ist global. Dabei vergaß ich keinen Augenblick, daß ich damals selbst bei den heute sonderlich- und lustigsten Unfallphotos manchmal das Versteck hinter einer Hecke suchte – Heulen bei Polizisten gab’s nicht. Nie!
Sie hatten nie einen Autounfall?
Nein, aber es war viel Glück im Spiel. Nicht – wie fast bei allen Autounfällen – wegen Alkohols; ich war immer trocken wie ein Steuerbescheid. Wild rasende Polizeiautos gab’s nur im Radiohörspiel, später im Fernsehen. Die eheliche Wirtschaftsführung stand bei meiner Besoldungsstufe unter einem haushälterischen Stern, also fuhr ich einen DKW 3=6, anthrazit, beiges Dach und Weißwandreifen, mit Dreizylinder-Zweitakt-Motor und Fliehkraftkupplung, die den leichten Wagen endlos im Leerlauf ausrollen ließ, wenn ich kein Gas gab. Wenn keiner schaute, kurz auf die Höchstgeschwindigkeit 123 km/h beschleunigt, dann Fuß weg vom Pedal – und der DKW rollte wunderbar verbrauchsfrei durch ganz Nidwalden.
Ich versuchte, so wenig wie möglich zu bremsen – die Bremswirkung der Trommelbremsen war ohnehin überschaubar: Notfälle nicht vorgesehen – und die Kurven in direktester Linie zu fahren, um möglichst viel kostspielige, zweitakttypische Benzin-/Ölmischung zu sparen. Ich kann mein damaliges Trachten nicht nachvollziehen, aber ich drehte gar Heizung, Licht und Scheibenwischer aus, in der Annahme, der Wagen werde etwas weiter rollen. Dank des unkultivierten Leerlaufverhaltens und des stotternden DKW-Furzens wußten alle zwischen Stanser- und Buochserhorn, wo ich im Diensteinsatz war – und ich wußte meinerseits, daß der Motor im Ausrollen lief, denn wenn er ausging, rastete die Lenkradverriegelung ein, und das war dann blöd. Aber das Glück stand all die Jahre auf meiner Seite. Die Dellen stammten von meiner Gattin.
Gab es Schnappschüsse, oder war alles geplant und inszeniert?
Ja, viele. Man erkennt sie an den schlechtgelaunten, genervten Gesichtern auf den Photos. Schnappschüsse brauchten Zeit, bis sie perfekt waren, sonst wären sie Pfusch, und das ging gegen meine Photographenehre. Die Leute warteten leider nicht gern, bis der richtige Hintergrund in der richtigen Achse lag, bis das Licht paßte und die Sonne sich endlich von der Wolke löste, bis eine Treppe, eine Mauer oder eine Kiste gefunden war, damit die Kamera auf Augenhöhe kam – die der Leute, nicht die des Photographen... –, bis das Bild ein schönes Ebenmaß hatte oder dieses herausfordernd brach, und bis alle Bildbezüge streng verortet waren. Schließlich mußte alles Unnötige weg – „alles“ konnte ich recht streng sehen. Da ich gern eine schöne, große Tiefe suchte und Krempel, auch Zaungäste in grellen Blusen und bunten Hemden, selbst in der Unschärfe des Horizonts, störte, konnte ein spontaner, schneller Ferien- oder Ausflugschnappschuß – auch hier nur eine einzige Aufnahme: sparsam blieb wie ein Leberfleck – gern eine Stunde Improvisation fordern. Aber dann, endlich!, alle hielten die Luft an – stop, Moment! Zwar leider außer Hörweite, aber die beiden versteckten Damen da hinten warteten zu nahe an der Ecke: ihr Schatten fiel auf die Straße...
Am häufigsten sind auf den Photos die schmalgepreßten Lippen meiner Familie zu sehen. Meine Frau, meine Kinder, sie kannten die Zeit, die ein spontaner Schnappschuß forderte. Sie waren immer wachsam, mich von Schnappschußmotiven fernzuhalten, ohne wenigstens einen Imbiß oder ein Buch dabeizuhaben.
Gibt es Photomotive, die Sie verpaßten?
Ich habe in Nidwalden in den achtzig Jahren jeden Stein, jeden Ast, jede Pfütze, jede Nase photographiert. Mehrmals. Von allen Seiten. Bei jedem Wetter. Da bleibt kein Wunsch offen.
Was ich nicht photographierte, weil ich nicht dazu gekommen bin, sind die Gesichter der Besucher vor den Photographien bei meinen vielen Ausstellungen. Diese Sammlung hätte ich gerne. Noch lieber hätte ich Tonaufnahmen der Kommentare und Bemerkungen über die Photos. Oder beides. Ist diese Neugier eitel, eine Sünde? Pardon, ich hatte im Heimspiel nie eine Überdosis an Zuspruch.
Natürlich sind die Steidl-Bücher meines Sohns großartig, prächtig, meisterlich, und das zwanzigjährige Interesse an den Editionen der Photographien macht mich stolz. Aber Buchkäufer lerne ich selten kennen, und Galeristen sind Könige der Diskretion, darum waren und sind die Ausstellungen für mich das große Spektakel. Da sehe ich die direkte, spontane Reaktion der Besucher. Die Wirkung des Bilds. Den Moment der Überraschung. Sofort, live und mit eigenen Augen. Toll!
Photographieren Sie noch?
Leider nein. Meine Sehkraft läßt nach, ich habe Probleme mit der Netzhaut, und ohne die Schaffenskraft der Augenärzte wäre ich erblindet. Aber Interesse, Neugier und Fieber sind ungebrochen. Jasmin Morgan richtete mir einen Rechner mit Bildschirmlupe ein, so kann ich meine Photos in Ausstellungen, Büchern und Zeitschriften auf der ganzen Welt verfolgen – ich habe gesehen, wie Arnold Odermatt in chinesischer, japanischer, kyrillischer, arabischer, hebräischer, georgischer, indischer und in thailändischer Schrift geschrieben wird.
Es gab Ausstellungen, die großartig waren. Stefano Stoll zeigte am Festival Images Vevey den Polizisten Noldi von Büren, der damals am autofreien Sonntag auf einer Nidwaldner Straßenkreuzung den Handstand machte, fünfhundert Quadratmeter riesig an der fünfstöckigen Hausfassade der Waadtländischen Kantonalbank. Im Netz sieht man, wie zwei langfingerige Kransteiger die Photoplane wie einen Vorhang über die Gebäudefront ziehen. Als mich der Festivalchef im Golfwagen hinfuhr, rutschte mir die Bemerkung heraus, daß dies die richtige Größe für meine Photos sei. Stefano Stoll war nicht überrascht und meinte, Straßenschluchten mit langen Häuserfassaden gäbe es in Vevey leider nicht. Das Festival Images müßte in eine Reißbrettstadt wie La Chaux-de-Fonds umziehen.
„Karambolage“, „Im Dienst“, „In zivil“ und „Feierabend“ erschienen im Steidl Verlag, Göttingen. Wie war die Zusammenarbeit?
Ich habe Gerd Steidl nur zweimal gesehen. Einmal in Zürich – er hielt einen Vortrag und küßte mich wie ein Russe zur Begrüßung auf der Bühne. In Nidwalden kennen wir so etwas nicht, aber zum Glück war kein Nidwaldner im Saal. Die Journalistin einer Zürcher Zeitung leitete den Abend und stellte den Stargast vor: „Herr Steidl, Sie sind der König des Steidl Verlags!“. Gerd Steidl antwortete trocken: „Nein, der Diktator.“ Die Journalistin war verstört, das Publikum nachdenklich, aber mein Sohn kam immer sehr, sehr glücklich von der Arbeit aus Göttingen zurück.
Beim ersten Treffen war ich zu einem Abendessen im Messeturm anläßlich der Frankfurter Buchmesse eingeladen. Der Gastgeber Gerd Steidl suchte mir einen schönen Platz aus, massierte mir nach dem Hinsetzen den Nacken und führte mich in ein sehr nettes Gespräch mit dem älteren Herrn gegenüber ein. Wir zwei Rentner unterhielten uns den ganzen Abend angeregt, worüber sich Rentner halt den ganzen Abend unterhalten – „nein, am Kreuz zwickt es mich weniger, ich habe eher Schmerzen am Knie“, „oh, nein, zu Fuß bin ich eigentlich noch ganz gut, aber mein Rücken, wissen Sie, ist nicht mehr wie früher“ –, es war ein schönes Plaudern über die wichtigen Dinge des Lebens. Mein Sohn sagte später auf der Autobahn, der nette Rentner hieße Grass und sei Nobelpreisträger. Schade, ich war gar nicht dazugekommen, zu erzählen, daß ich Polizist in Nidwalden war.
Haben wir eine Anekdote vergessen?
Spontane Geschichten waren nie meine Stärke. Wir Polizisten halten Tatbestände fest, wir antworten, wenn wir vom Richter gefragt werden. Seit mein Gehör nachgelassen hat, muß ich dazulernen. Zu meinem neunzigsten Geburtstag kuratierten Heide und Robert Springer eine Ausstellung in ihrer Galerie – auch mit meinem Langzeitprojekt: der Baum auf dem Ennerberg in Buochs (ich habe nicht hundert Bäume, sondern über Jahre hundertmal den einen Baum photographiert) –, und sie luden zu einer kleinen Feier nach Berlin ein. Die kleine Feier war eine rammelvolle Galerie mit noch einmal so vielen wartenden Leuten draußen vor der Tür in der Fasanenstraße. Ich saß mit den Gastgebern, der Gesprächsleiterin Dr. Beate Kemfert aus Frankfurt am Main und meinem Sohn an einem Tisch mit Mikrophon vor dem Publikum und wurde von einem Wasserfall an Fragen empfangen. Da ich bei diesem Stimmengewirr keine Frage verstand und diese Blöße nicht preisgeben wollte, dachte ich mir eigene Fragen aus und erzählte ausführliche Antworten und Anekdoten. Den Leuten gefiel das, und je mehr es den Leuten gefiel, desto mehr geriet ich in Fahrt. Daß die Antworten nichts mit den Fragen aus dem Publikum zu tun hatten, merkten nur ein paar schnäubige Journalisten.
Auf der Heimfahrt quälten mich Zweifel, ob mich die Leute in der Galerie überhaupt verstanden haben. Ich bemühe mich stets um ein sauberes, deutliches Hochdeutsch, so gut wir Nidwaldner dazu in der Lage sind. Den Bußgeldbescheid auf dem Weg zum Skiurlaub in Engelberg verstanden die deutschen Gäste stets, wenn sie zu hurtig unterwegs waren. Gut, das waren vielleicht Schwaben und Alemannen, keine Berliner. Seit einem Interview beim Westdeutschen Rundfunk bin ich mißtrauisch: Ich schilderte im Museum Morsbroich in Leverkusen dem Journalisten das Entstehen der Karambolage-Photos in bestem Hochdeutsch – der Beitrag wurde deutsch untertitelt ausgestrahlt. Da man die ARD in Nidwalden empfangen kann, getraute ich mich kaum nach Hause.
Die 39 Fragen von Sebastian Gansrigler, Auslöser, Wien, beantwortete Arnold Odermatt bei verschiedenen Besuchen in Stans. Das Gespräch wurde in Nidwaldner Mundart geführt. Der Herausgeber Urs Odermatt hat die Antworten deutsch transkribiert.
Auszüge der 39 Fragen an Arnold Odermatt sind in englischer Übersetzung im März 2021 in der Ausgabe vier des Auslösers erschienen.
*
Ich sammle nicht. Ich bewahre auf. Weil man nichts wegschmeißt, was man noch brauchen kann. Weil man später nie etwas braucht, geht es vergessen. Weil es keiner entdeckt, bleibt es verloren. Ich habe Glück gehabt.
Arnold Odermatt
*
Jeder macht Photos. Die Welt ist voll mit Photos. Großartig reicht nicht. Man muß den Künstler im Werk erkennen, ohne daß man seinen Namen liest.
Urs Odermatt
*
Es ist ein sehr gutes Interview geworden. „Großartig“, auch wenn „das nicht reicht“.
Dr. Beate Kemfert
Opelvillen, Rüsselsheim
*
Die Leute schimpften beim Regierungsrat, wenn sie wegen meiner Photos warten mußten. Da setzte ich den Unterhaltsdienst ein – etwas zu reparieren gab es auf der Autobahn immer. Nein, „Phantombaustellen“ waren das nicht.
Arnold Odermatt
*
Künstler haben das Recht, schwierig zu sein.
Gerhard Steidl
Photo 14, Zürich, 2014
*
Warten gibt schlechte Laune. Arnold Odermatt machte sie zum Stilmittel.
Urs Odermatt
*
Das Polizeilabor in der Besenkammer war so eng, daß sich keiner vorstellen konnte, wie ich hier den Abzug einer stattlichen Karambolage vergrößern sollte.
Arnold Odermatt
*
Ich habe nicht danach gesucht. Vergessene Schätze sucht man nicht. Über vergessene Schätze stolpert man. Weil der Mensch nichts wegschmeißt, wurden die Negative seinerzeit nicht entsorgt, obwohl ihrer Bestimmung gemäß zum schnellen Gebrauch bestimmt und bald so aktuell wie die Zeitung von gestern. Weil der Mensch nie etwas Aufgehobenes wiederverwendet, wurden die Photographien im Speicher vergessen. Der ausgemusterte Bilderberg mit den Nidwaldner Karambolagen alterte und reifte wie Branntwein in Eichenfässern durch die Zeitläufte. Als ich eines Tages die Arbeiten wieder in der Hand hielt, wußte ich: Das ist ein großer Fund! Der Photograph Arnold Odermatt hatte sein Thema gefunden. Ein Thema, das er mit niemandem teilen mußte. Jetzt wird es überleben.
Urs Odermatt
*
Ich führte bis fünfundsiebzig das interessante Leben eines Polizisten. Seit ich fünfundsiebzig bin, führe ich das interessante Leben eines Künstlers.
Arnold Odermatt
*
Die Schönheit von Form und Funktion. Strenge Reduktion. Aufgeräumte Schlichtheit. Woher kennen wir das? Brecht? Bauhaus? Kannte Arnold Odermatt nicht. Er war Polizist in Nidwalden.
Urs Odermatt
*
Meine erste Kamera kannte die Distanzangabe nur in britischen Fuß, nicht in Metern. Die Distanz von Optik zu Motiv mußte ich nach Augenmaß schätzen – in Nidwalden haben wir verschieden große Füße.
Arnold Odermatt
*
Mit der Genauigkeit eines Chronisten hat Arnold Odermatt sein photographisches Notizbuch geführt.
Till Schaap
Benteli Verlag, Bern
*
Er photographiert Unfälle und schuf Kunst
Arno Renggli
Luzerner Zeitung, 21. Juni 2021
*
Kein versehrter Mensch ist zu sehen, kein Tropfen Blut – trotzdem verweisen die Bilder mit Wucht auf das Ende des Lebens. (...) Odermatts Welt ist aufgeräumt, ordentlich und friedlich zerbeult. Darüber hinaus ist sie intensiv wie der letzte Atemzug.
Roland Grüter
Vögele Kulturbulletin, Pfäffikon, 113/2022
*
Arnold Odermatt war im Sommer 2002 an die HfG Karlsruhe zu einem Vortrag eingeladen – er begann mit der Bemerkung, daß er noch nie so viele schöne Frauen auf einmal gesehen hätte. Dann wurde er richtig streng – das war für die Studenten neu. Arnold Odermatt hat fast drei Stunden gesprochen, zu jedem Bild die ganze Geschichte. Er war und ist großartig!
Prof. Dr. Rolf Sachsse
Bonn
*
Not even in my wildest dreams would I have thought of myself as an artist back then, it was a craft. I simply had the ambition to produce technically demanding work.
Arnold Odermatt
in: Dr. Ricarda Vidal
Caspar David Friedrich through a Broken Windscreen – Arnold Odermatt’s Peaceful Crash Scenes
Static 07, The London Consortium, London 2008
nach: Stefan Domke
Bei Odermatt wird die Karambolage zur Kunst – Leverkusener Museum widmet Schweizer Polizeiphotographen eine Ausstellung
Westdeutscher Rundfunk, Köln, 21. März 2002
*
Quelle découverte! Ce photographe policier travaillant la mise en abîme, le désastre et la glorification de son métier est pour moi l’essence même de la contradiction helvétique, de la richesse d’un imaginaire coincé entre rigueur et ouverture.
Nicole Giroud
Le Monde, Paris, 31. August 2012
*
Volles Haus, bis auf die Straße!
Heide Springer
in: Au revoir, Arnold Odermatt
Ein Film von Jasmin Morgan
Privat war,
wenn das Telephon nicht klingelt
von Matthias Dell
Ein Gespräch mit Urs Odermatt über Arnold Odermatt, das Aufwachsen in Nidwalden, Magnesium auf dem Raddeckel, die Arbeit bei der Polizei und das lange Warten auf den Klick.
Wie muß man sich das Nidwalden von Arnold Odermatt vorstellen?
Es gibt einen alten Witz, mit dem die Nidwaldner Zugezogene domestizieren: Drei Männer sitzen in einer Kneipe. Nach einer gewissen Zeit sagt der erste: „So.“ Fünfzehn Minuten später der zweite: „So.“ Dann meldet sich der dritte zu Wort, ein zugezogener Zürcher: „Soso.“ Die beiden Nidwaldner starren vorwurfsvoll: „Schwätzer.“
Wie unterscheidet sich Nidwalden von anderer Provinz?
Nidwalden ist ein Bergtal, das früher nur über eine See-Enge erreichbar war, mit einer Drehbrücke für die Schiffahrt, die gesperrt werden konnte, wenn zu viele Zürcher im Anmarsch waren. Inselmief also. Rundum Berge, steil wie Wände. Jeder kennt jeden. Jeder weiß über jeden alles. Die Leute heißen alle Odermatt. Fast alle. Meine Mutter als Mädel auch, das ist in Nidwalden ganz normal. Sie hat nie verstanden, warum der Künstler nicht als Arnold Odermatt-Odermatt bekannt wurde. Meine erste Reise in die norddeutsche Provinz war wie eine Droge: Flach! Endlich Horizont!
Wie lang ist Ihre Familie dort schon ansässig?
Schon immer. Die Familie ist ausgesprochen „arisch“, würde ich sagen. Es gab immer fast nur Odermatts, Amstutz’ und andere Nidwaldner Namen. Auswärtigen Frauenfrischfleischnachschub gab’s für Nidwaldner höchstens beim Militärdienst im Tessin. Gut, die Odermatts waren schon immer Rebellen, darum ist in der Vergangenheit auch Angeheiratetes aus Südtirol aktenkundig. Sonst war die Gesellschaft geschlossen. Wie früher bei den Juden, bei den Zigeunern, beim Hochadel: Man blieb unter sich. Ein Tal, elf Gemeinden, Stans ist der Hauptort.
Wovon leben die Leute?
Landwirtschaft, Forstwesen, Handwerk, Gastgewerbe. Nidwalden ist katholisch, das heißt jede Menge Kneipen, vor allem sonntags. Die Leute haben nach dem Kirchgang Durst. Dazu paßt die Hauptermittlungslast der Nidwaldner Kantonspolizei, neben den Karambolagen: Wilderei und Verstoß gegen den amtlichen Kneipenschluß. Dann die Pilatus Flugzeugwerke; sie hatten den Duft der großen weiten Welt, besonders seit auf deren Gelände in den sechziger Jahren ein paar Szenen des James-Bond-Films Goldfinger gedreht wurden. Und die untergegangenen Schilter-Werke; sie bauten in Nidwalden „den besten Traktor der Welt“.
Wie kam da früher Welt hinein?
Für die damals vielleicht 18’000 Leute gab’s drei Tageszeitungen aus Luzern, mit Lokalseite für Nidwalden: eine katholisch, eine freisinnig, eine weder noch. Sie waren sich nie einig, aber den Unterschied mußte man mit der Lupe suchen. Jeder wußte, was jeder las. Man ging sich aus dem Weg, setzte sich an einen anderen Tisch, doch man saß in der gleichen Kneipe. Alles war öffentlich und unter Kontrolle. Es war wie analoges Facebook. Es gab damals genau zwei Welten: wir und die anderen.
Wie ist Ihr Vater aufgewachsen?
Arnold kam aus einer kinderreichen Familie in Oberdorf, einer der elf Nidwaldner Gemeinden. Der Vater war Förster, Kantonsförster gar, also verbeamtet, aber mit eigenem Hof. Die Familie war erst größtenteils Selbstversorger, das heißt, die Mutter arbeitete in Haus und Hof und machte Buchhaltung, Steuererklärung, Kinder; der Vater verteidigte derweil das Vaterland. Als Kavallerist, also mit sehr großem Zeiteinsatz. Die spätere Beamtenstellung Arnold Odermatts, des Älteren, hat der Familie sehr geholfen. Der Jüngste durfte studieren, und eine Nonne gab’s auch. Trotz der vielen Armee- und Forstaufgaben waren es viele Kinder, ich glaube, die Zahl war zweistellig. Mit meinen Vettern und Basen, auch mütterlicherseits, könnte ich eine Kleinstadt füllen. Die meisten habe ich nie gesehen.
Sie wissen es nicht genau?
Arnold hat einmal gesagt: Sie waren sechs Brüder, die Schwestern hätte er nie gezählt. So war damals der Jargon. Ich kenne sie nicht alle, einige habe ich nur ein-, zweimal bei Familientreffen gesehen. Soweit ich weiß – mit einer Ausnahme leben sie alle noch. Obwohl sie in Nidwalden den Führerschein hatten.
Diffundiert Verwandtschaft dann ins Dorf, oder gibt es selbst innerhalb so kleiner Gemeinden noch einmal einen Zusammenhalt in der großen Familie?
Es gab die drei Säulen: Familie, Kirche, Militär. Diese drei Säulen definierten die Welt Nidwaldens. Wer dazugehörte, gehörte dazu. Wer nicht, suchte sich seine eigene Welt. Geographisch, beruflich, sozial. Lebte ein anderes Leben. Innere Immigration gab es vielleicht auch. Doch die meisten, die anders waren, gingen anderswo hin. Abseits, aber bleiben, war selten. Das hieß nicht, daß Nidwalden nicht wunderbare Heimat sein konnte. Aber halt ein sehr klar definiertes Paradies. Ich weiß noch, wie vertraut mir die DDR bei meinem ersten Besuch war: die Nähe von Mief und Gemütlichkeit, die Nähe von Sicherheit und Bevormundung, das Schimpfen über die eigenen Verhältnisse und die geschlossenen Reihen, wenn ein Fremder dies tat. Sozialismus und Katholizismus mögen diametrale Systeme sein – die Details waren sich sehr ähnlich. Heute wird Nidwalden sein wie jede verstädterte Agglomeration. Ich weiß es nicht, ich bin zu lange weg.
Wo würden Sie Ihren Vater verorten?
Arnold war sehr harmoniesüchtig. Mußte er Bußen verteilen, schmerzte ihn das mehr als den Delinquenten. Der Unterschied zwischen uns beginnt schon, wenn Sie, Herr Dell, „Ihr Vater“ sagen. Ich muß da immer kurz nachdenken, wer gemeint ist: Für mich ist Arnold Arnold. Wir sind Berufskomplizen, eine Konstellation zweier Künstler. Wenn es die Photographie nicht gäbe, hätte ich kaum Kontakt zu ihm, wie ich kaum Kontakt zu meiner Verwandtschaft habe. Aber durch die Arbeit, die Photographie, ist unsere Verbindung eng, freundschaftlich, inspiriert. Ich kümmere mich um ihn. Er ist bald zweiundneunzig, wir fahren wöchentlich hin und schauen, daß es ihm gut geht. Jasmin Morgan hat Arnold einen Rechner online gestellt. E-Mail interessiert ihn nicht, aber seinen Namen googeln macht ihm mächtig Spaß, und einen Club der Hundertfünfjährigen hat Arnold im Netz auch gefunden. Das hat alles nichts mit Familie zu tun, obwohl diese natürlich erbrechtlich relevant ist: Wäre Arnold nicht mein Vater, wäre ich nicht der Herausgeber seiner Werke. Aber die Harmoniesucht teilen wir nicht. Ich ziehe meine Pläne durch. Wer Teil davon sein möchte, ist herzlich willkommen und bekommt alles, wer nicht, ist schon vergessen. Das Resultat ist für mich Lob oder Tadel. Arnold hatte die entwaffnende Größe, mir sein Werk mit allen Rechten bedingungslos anzuvertrauen: „Mach! Du wirst schon wissen, was.“ Er hat die Entscheidung nie bereut, denke ich.
Gilt das auch umgekehrt: Wenn Sie nicht der Sohn wären, würde es ihn als Künstler nicht geben?
Nein, würde es nicht. Bis ich Arnolds Photos entdeckt habe, sind sie im Speicher vermieft. Da er sich selbst nicht als Künstler gesehen hat, gab es keinen Grund für ihn, am Vermiefen etwas zu ändern. Eines Tages wäre alles entsorgt worden. Ohne die Gnade der langen Auslandsabwesenheit hätte ich das Besondere der Photographien nicht erkannt. Zu vertraut die Motive auf den Föteli. Die Entdeckung war reiner Zufall. Als ich 1992 meinen Spielfilm Wachtmeister Zumbühl, die Geschichte eines photographierenden Polizisten, dessen Sohn straffällig wird, vorbereitete, habe ich mich erinnert, daß Arnold immer photographiert hat. Er war in meiner Jugend kaum zu Hause, weil es immer eine Hundsverlochete (eine Hundeverscharrung – einen Nicht-Anlaß) gab, die er ablichten wollte. Jetzt war Arnold seit kurzem in Rente. Ich habe ihn gefragt: „Dir ist bestimmt langweilig, willst du nicht Standphotos bei meinem neuen Film machen?“ Ich habe erst bei den Dreharbeiten gemerkt, wie absurd diese Situation ist: Arnold steht neben mir hinter der Filmkamera, vor der Kamera steht sein von Michael Gwisdek gespieltes Alter ego und photographiert mit Magnesium in der Radkappe, und der richtige Arnold macht die Standphotos seiner Lebensrolle.
Wie war Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater vor der künstlerischen Zusammenarbeit?
Arnold war immer im Dienst. In Bereitschaft. Ich habe das nachts schreiende Funkgerät („Niwa eins! Von Niwa zwei. Antworten! – Verstanden. Antworten! – Verstanden. Unfall in...“) stärker in Erinnerung als ihn in der Rolle des Vaters. Arnold war aber schon damals pragmatisch. Ich bin früh mit meiner damaligen Freundin zusammengezogen, wir waren keine fünfzehn. Das war natürlich nicht erlaubt, selbst volljährig nicht. In Nidwalden gab’s ein Konkubinatsverbot. Polizist Arnold Odermatt hat mir damals zugesteckt: Hier in Nidwalden sei wilde Ehe ein Offizialdelikt, er müsse ermitteln und „Du kriegst Ärger“. In Engelberg, zwanzig Kilometer entfernt in Obwalden, sei dies nur ein Antragsdelikt. Wenn keiner Anzeige erstattet, wird nicht ermittelt. „Zieht doch da hin und schaut, daß die Nachbarn nichts hören“, sagte mir der Bulle, mein Vater. Über Obwalden sprach man damals in Nidwalden nicht, aber ich zog hin und fuhr jeden Morgen in unmenschlicher Frühe mit der Bahn in die Stanser Klosterschule. Dies ist eine frühe Erinnerung an Arnolds Pragmatismus. Im Grunde waren wir schon damals Komplizen. Später, als ich nach dem Abitur vor der Armeepflicht nach Deutschland abgehauen bin, mußte Arnold wegen mir wieder im Fahndungsbüchlein blättern. Da war der Kontakt nicht so intensiv. Aber auch da rief Arnold ab und zu an. Wenn er Hilfe beim Texten einer Bildunterschrift brauchte.
Wie ist er denn Polizeiphotograph geworden?
Arnold war gelernter Bäcker und Konditor. Lehre in Kriens, Geselle in Zürich und La Chaux-de-Fonds, bis er eine Mehlstauballergie bekommen hat. Da mußte er den Beruf aufgeben. Arnold war ziemlich ratlos und faßte einen radikalen Entschluß: Auswandern in den damaligen Belgisch-Kongo. Das war sehr familientypisch: Entweder man unterwarf sich dem Leben im Dorf mit Haut und Haar, oder man machte einen Strich und stieg ganz aus. Aber dann hat Arnold Odermatt, der Ältere, mein Großvater, Arnold Odermatt, dem Jüngeren, den Job bei der Polizei besorgt. Die Vorgesetzten hatten Arnold nicht geshortlistet und fanden ihn ungeeignet, zu weich, zu konfliktscheu. Als Polizist brauche man eine gewisse Härte. Doch der Kantonsförster hat sich kraft seiner Position durchgesetzt mit dem Argument, daß die Arbeit Arnold schon abhärten werde. Außerdem sei er „im Welschen“ gewesen; daß der Bäcker in La Chaux-de-Fonds allein nachts in der Backstube wenig Französisch hörte und sprach, wandte niemand ein. Eine Kamera hat Arnold übrigens schon am ersten Diensttag bei der Kantonspolizei Nidwalden eingesetzt; in der Polizeischule besaß er noch ein Billigteil, wie jenes, das er bei einem Wettbewerb gewonnen hatte.
Bei einem Wettbewerb?
Ein Sammelwettbewerb der Zürcher Seifenfirma Friedrich Steinfels AG: Wer als erster eine bestimmte Reihenfolge von Karl-May-Bildern gesammelt und ertauscht hatte – vollständig, wie ein Rabattmarkenheft –, konnte ein Los ziehen. Arnold hatte Glück.
Den Apparat hat er dann einfach mit zur Arbeit genommen?
Die 1935 – Arnold war zehn Jahre alt – gewonnene Boxkamera war ein besseres Werbegeschenk, das zwar Mittelformat nutzte und 6×9-Negative lieferte, aber wegen seines einlinsigen Objektivs nur ganz flaue Bilder machte, mit der langen Verschlußzeit nur unbewegte Motive zuließ und schnell und verläßlich kaputtging. Sie hatte ein halbes Dutzend von Arnold käuflich erworbener Nachfolger, bis der letzte 1948 an der Polizeischule Luzern unter zupackenden Polizeirekrutenhänden den Geist aufgab. Bei seinem ersten Polizeieinsatz hatte Arnold eine neue, solide Männerkamera mit guten Objektiven und schneller Verschlußzeit, eine zweiäugige Rolleiflex 3.5 der damaligen Firma Franke & Heidecke, für die er mit einem Photohändler um einen kulanten Teilzahlungsvertrag gefeilscht haben muß. Ein paar Jahre später kam die lichtstärkere Rolleiflex 2.8 dazu; diese Kamera ist heute so alt wie ich und tut noch immer ihren Dienst. Bei diesem ersten Polizeieinsatz hätte Arnold eine Zeichnung von einem Unfall, einer klassischen Karambolage, machen sollen. Weil er schlecht zeichnen konnte, hat er die Situation kurzerhand mit der Rolleiflex photographiert.
War das damals üblich?
Arnold hatte sich einem Dienstverbot widersetzt und war froh, daß der Überseekoffer für Belgisch-Kongo noch im Keller stand: Zeichnen, nicht Photographieren war der Befehl. Der Vorgesetzte war außer sich – eine Photographie könne man schließlich manipulieren.
Das Photo, nicht die Zeichnung?
Damals waren Doppelbelichtungen bei Postkartenmotiven sehr populär. Bei den beliebten Postkarten des Stanserhorns hatte der unbekannte Photograph für die Touristen im Hintergrund das Matterhorn einkopiert. Jeder wußte von dieser Lüge. Bleistiftzeichnungen jedoch galten als dokumentarisch, ein Abbild der Wirklichkeit. Arnold hatte zufälligerweise ein Gespräch belauscht, bei dem der Richter seinen wegen der Befehlsverweigerung noch immer aufgebrachten Vorgesetzten für dessen innovative Ermittlungsmethoden lobte. Einsatz der Photographie für das Protokoll eines Verkehrsunfalls: Das sei eine tolle Idee, da könne er als Richter sehen, was vorgefallen sei, als sei er dabei gewesen. Der schwitzende Vorgesetzte hatte kurz durchgeatmet und die Front gewechselt. – Klar, man müsse selbstverständlich mit der Zeit gehen. So hatte Arnold durch den Türspalt mitbekommen, daß Rausschmiß und Auswandern nicht anstand. Das war 1948, gleich zu Beginn seiner Dienstzeit.
Wissen Sie etwas über künstlerische Einflüsse?
Arnold ist völliger Autodidakt. Er verstand sich als Künstler, als er noch Konditor war. Er hat Hochzeitstorten hochgezogen, das war für ihn kreativ. Das waren mitunter Riesenteile, gekonntes Kunsthandwerk. Aber die Kamera war für ihn ein Werkzeug und die Photos Gebrauchsprodukte. Protokoll. Gericht. Versicherung. Manchmal Lokalpresse. Arnold hat versucht, sein Produkt möglichst gut zu machen: „Ein gutes Bild muß scharf sein.“ Er stand dabei auch vor Herausforderungen: Es war Nacht, es regnete, er brauchte eine aufsichtige Situationsaufnahme mit einem großen Schärfebereich. Blitzlicht reichte hier nicht weit, und Lichtsetzen ging nicht, weil sich der Unfall nicht die Nähe einer Steckdose gesucht und die Nidwaldner Kantonspolizei damals kein Stromaggregat hatte. Also hatte sich Arnold Magnesium besorgt, – wenn es schnell gehen mußte – die Radkappe seiner DKW-Limousine abgenommen und das Pulver darauf angezündet. So konnte er sein Bild in Langzeitbelichtung machen, weil das Magnesium dreißig Sekunden lang hell war. Bei der sehr langen Belichtungszeit konnte er sogar selbst ins Bild gehen und mit dem Magnesium das Licht wie ein Maler nachleuchten, wenn er sich quer längs und nicht in die Tiefe bewegte, so daß es für ein Ablichten seiner Bewegungen nicht reichte.
Wann kam der Technikschub? Wie sah seine Ausrüstung aus?
Was perfekt funktioniert, funktioniert perfekt. Da braucht es keinen Schub. Mehr muß nicht. Weniger geht nicht. Das war Arnolds Einstellung. Ich habe ihn immer nur mit einer seiner beiden zweiäugigen Rolleiflex, in die man von oben in den Sucher schaut, arbeiten sehen, der Rolleiflex 3.5 und der baugleichen, aber lichtstärkeren Rolleiflex 2.8. Beide hatten feste Optiken, die man nicht wechseln konnte. Beide waren im Dienstalltag der Nidwaldner Kantonspolizei nicht totzukriegen. Da Arnold die Optik nicht wechseln konnte und für seine Aufsicht auf das Dach des VW-Busses steigen mußte – oft mitten auf der gesperrten Straße –, mußte er sich gut überlegen, wie die Cadrage aussehen sollte. Später hatte er eine Rollei SL 66 mit Wechseloptiken und eingebautem Balgen; soweit ich weiß, stand sie aber nie in dienstlichem Einsatz. Und es gab Landschaftsaufnahmen, die Arnold mit einer Pentax 6 × 9 gemacht hat. Kleinbildphotographie hat ihn nie interessiert, digitale Photographie schon gar nicht. Arnold macht heute mit seinen süffisanten Bemerkungen die Photographen, die ihn, den berühmten Photographen, porträtieren sollen, hypernervös: Ein Bild reiche doch. Suchermonitore seien für Mädchen. Das perfekte Photo hänge später tropfend im Labor.
Hat er damit auch privat photographiert?
Was heißt schon privat? Er war sieben Tage die Woche vierundzwanzig Stunden am Tag in Bereitschaft. Seine Kollegen, meistens einer pro Ortschaft, hatten ein Bureau. Ein Mann mit Bureau ist immer sein eigener Chef, man bleibt auf dem angewärmten Stuhl, wenn nicht wirklich Not am Manne ist. Arnold hatte kein Bureau, er war die Rufnummer 117, sonntags, nachts, feiertags. Privat war, wenn das Telephon nicht klingelte. Es klingelte sehr oft, sonst müßte ich die Herausgeberschaft des Werks mit Brüdern teilen. Wegen der finanziellen Situation mit Familie und kargem Beamtengehalt war Geiz Lebenshilfe: von jedem Ereignis gab es grundsätzlich nur ein Bild. Auf dem Negativstreifen im Labor zeigte somit Bild eins etwa eine Karambolage mit Landschaft, Bild zwei meine Schwester beim Spielen, Bild drei eine weitere Karambolage, diesmal mit Personenschaden, Bild vier einen Akt meiner Mutter, Bild fünf Wachtmeister Zumbühl beim Reinigen der Dienstpistole am Küchentisch, Bild sechs das Stanserhorn im Zwielicht. Alles auf dem gleichen Negativstreifen. Kein Dienstfilm, kein Privatfilm, ein Odermattfilm.
Aber das Material wurde ihm gestellt?
Ich glaube, daß die Kantonspolizei Arnold das Labor eingerichtet und die baulichen Maßnahmen sowie die Strom- und die Wasserrechnung bezahlt hat. Aber Negativfilm, Papier, Chemie und die Photokamera, das kam alles von Arnold. Die Polizei war damals sehr schweizerisch, der Staatsgeiz hat jeden Rappen gezählt. Kein Wunder, daß Arnold jedes Motiv nur einmal photographiert und nur nach Ansage vergrößert hat.
Wo war das Labor?
Das frühe Labor war in unserem Badezimmer, das werde ich nie vergessen: Das erste, was ich von Photographie wußte, war, daß sie stinkt. Später gab’s ein Labor im Polizeigebäude, in einem ehemaligen Klo. Wegen des vorhandenen Wasseranschlusses. Das muß Anfang der sechziger Jahre gewesen sein.
Wie haben die Kollegen seine Arbeit wahrgenommen?
Das war Arnolds Lebenskonflikt: Seine Photographien haben in Nidwalden niemanden interessiert, wenigstens nicht in seiner Wahrnehmung. Sie waren einfach da. Man hat sie genutzt. Lob ist in Nidwalden nicht endemisch. Man hat billigend in Kauf genommen, daß es bei Arnold dauert. Wenn man nur ein Bild macht, aus finanzieller Notwendigkeit, muß es perfekt sein – bis es perfekt wird, dauert das. Nicht nur bei den Karambolagen, auch bei den Bildern, auf denen Kollegen, Nachbarn oder die Familie posieren. Weil’s halt gedauert hat, waren diese Leute bald schmallippig bis bepißt. Die genervten Gesichter sind stilbildend geworden für Arnolds Werk. Später gab’s in Stans einen Dorfphotographen. Aber der wollte Geld haben. Weil man in Nidwalden weiß, wo der Geldbeutel sitzt, ging Arnold die Arbeit nicht aus.
Wie hat Ihr Vater die Bilder und Negative aufbewahrt?
Die Prints waren in Kodak- und Agfaschachteln gestapelt, die Negative einzeln in Hüllen in langen Holzbehältern in einem Riesenschrank im Speicher gesammelt. Im Sinne wirtschaftlicher Haushaltsführung in zugeklebten und dann halbierten grauen Amtsumschlägen sortiert. Vom ursprünglichen Nutzen der Holzbehälter habe ich erst später erfahren: Wenn Gastarbeiter nach Nidwalden kamen, brauchten sie für die Arbeitserlaubnis einen Paß. Der Personalausweis reichte nicht. Bei der Einreise mußte der Paß bei der Polizei deponiert werden, bis die Gastarbeiter mit der Postquittung nachweisen konnten, daß die Einkommenssteuer bezahlt war. Dann kriegten sie den Paß wieder und durften nach Hause. Die langen Holzbehälter dienten zum Aufbewahren der Pässe. Als dieses nette Verfahren abgeschafft wurde, hat Arnold die Kisten genutzt, um seine Negative darin aufzubewahren. Wenn er die Holzbehälter nicht gehabt hätte, hätte er die Negative vielleicht einzeln gelocht und in einem Ordner abgelegt.
Wurde systematisch archiviert?
Nach Motiven und Ortschaften. Das Problem waren die billigen Plastikhüllen, die geleimt waren; Negative und Dias waren verklebt und von Chemie angegriffen. Arnold kannte da nichts und hat verklebte Stellen kurzerhand mit der Schere weggeschnitten. Ich habe dafür gesorgt, daß die Schere wegkam. Leider nicht ganz rechtzeitig. Gäbe es die digitale Revolution nicht, wären Arnolds Dias und Negative zu einem guten Teil Sondermüll: verpilzt, perforiert, beschädigt. Bei vielen Kodakbildern sind die Farben komplett weg. Nach dem Scannen der Originale hat Reiner Motz bei Steidl in Göttingen mit Photoshop gezaubert. Bei einem heute berühmten Dia hatte Arnold den leimverklebten Kirchturm mit der Schere weggeschnitten. Auf dem Scan (und auf den neuen Prints) ist er jetzt wieder da; restauriert an der Düsteren Straße nach Vorlagen im Netz. Jeder Nidwaldner schwört, daß der Kirchturm auf dem Bild nie weg war. Das ist eine schöne Klammer: Am Anfang der Karriere als Photograph stand der Verdacht der technischen Manipulation, und am Ende rettet digitale Manipulation Arnold Odermatts Karriere. Arnold selbst hat bei den Abzügen im Labor akribisch mit dem Licht gearbeitet. Auch dies als Autodidakt. Mal genial, mal gestört, aber alle handvergrößerten Prints von Arnold Odermatt sind Unikate. Analoges Photoshop, wenn man so will.
Wie hat er denn später auf seine eigene Bekanntheit reagiert?
Arnold hat nie verstanden, warum das Interesse um so größer wird, je weiter seine Photos aus Nidwalden hinausgehen. Was will er mit der Welt? In Nidwalden lebt er. Und in Nidwalden hat sich niemand für seinen Erfolg interessiert; eingeladen wurde er von der Biennale in Venedig und vom Art Institute in Chicago. Er fand es dann aber schon spannend, an diese Orte zu fahren. Nach Chicago gab’s einen Direktflug, am Flughafen holte ihn eine Limousine ab, er war in einem Hotelhochhaus einquartiert, und der Schweizer Generalkonsul hat ihn mit Namen begrüßt. Was Arnold irritiert hat, war das Symposium: Fünf Stunden lang saß er in einem Auditorium, und ein Dutzend Redner sprachen über ihn und seine Photographien, aber keiner bat ihn auf die Bühne. Dabei hatte er ein freundliches englisches Grußwort vorbereitet. Die Redner sagten nur kurz winkend, der Künstler sei anwesend, und weiter ging’s im Text. Ich hab’ Arnold dann erklärt, daß das die wahre Oberliga sei – es gehe nicht um ihn, es gehe um sein Werk. Aber was habe er davon, wenn das in Nidwalden keiner wisse. Arnold wollte in seinem eigenen Kanton jemand sein. Er wollte das Heimspiel. Das hat noch zehn Jahre gedauert. Dann bekam das Nidwaldner Museum eine nichteinheimische Leitung. Die neue Leitung aus Zürich hat gesehen, daß das Haus voll war mit Lokalkultur, aber der einheimische Weltstar fehlte. Stefan Zollinger, der jetzige Leiter, hat das 2013 für Nidwalden geändert.
Im Wikipedia-Eintrag ist von einer Begegnung mit Charlie Chaplin die Rede.
Personenschutz war Bestandteil von Arnolds Arbeit. Der Bürgenstock war immer ein wichtiger Konferenzort (Bilderberg-Konferenz 1960 und vieles andere). Die prominenten Gäste wollten ihre Ruhe: der indische Ministerpräsident Nehru, Adenauer, Charlie Chaplin. Arnold stand stoisch da in seiner Uniform, hielt ihnen Paparazzi und Autogrammjäger vom Leib, plauderte mit Adenauers Tochter Lotte (Adenauer wußte es besser: »Nein, junger Mann, das ist der Schwalmis, der Brisen ist rechts davon«, als Arnold Lotte die Nidwaldner Berge falsch aufzählte) und fragte manchmal, ob er ein Bild machen dürfe. Er fragte auch Charlie Chaplin, wenn die Anekdote stimmt. Arnold hat sich dann wohl beim Ablichten der Chaplin-Familie angestellt, es dauerte, wie immer, lange. Zu lange für Charlie Chaplin. Chaplin ist aus dem Bild getreten und hat Arnold gezeigt, wie man eine Inszenierung macht. Es gibt also im Werk eine Arbeit über die Chaplin-Familie – Regie: Charles Chaplin, Kamera: Arnold Odermatt. Photokamera natürlich, nicht Filmkamera. Und leider völlig verwackelt, weil auch Polizisten Nerven haben. Wobei ich davon ausgehe, daß auswärtige Schaulustige Arnold gesagt hatten, er solle ein Bild von Charlie Chaplin machen, das sei ein bekannter Schauspieler. Ich glaube nicht, daß Arnold damals schon einen Chaplin-Film gesehen hatte. Er hatte noch keinen Fernseher, und ins Stanser Dorfkino Remi ging man als Beamter nicht.
Und was ist mit dem Magnum-Photographen Werner Bischof? Der wird als Vorbild angegeben.
Reich-Ranicki hätte gesagt, kein Wort davon sei wahr. Bei Arnold ist vieles retrospektive Geschichtsschreibung. Ein schönes Beispiel: Im Art Institute of Chicago mußten wir mit Arnold – um zu seiner Ausstellung zu gelangen – durch eine Andy-Warhol-Halle ziehen, wo alles im Original hängt, was wir aus Büchern kennen. Robert Springer und ich waren begeistert, und der Name Andy Warhol fiel öfter an jenem Tag. Abends in der Kneipe fragte mich Arnold diskret: Wer ist denn diese Ännie? Wenn Sie Arnold heute nach Andy Warhol fragen, ist das ein ganz alter Spezi von ihm, und er war schon immer ein Vorbild. Das gleiche gilt für Joseph Beuys (1921–1986), dessen Werk Ausstellungsnachbar auf der Biennale 2001 war. Arnold erzählt heute stolz, daß er auf der Biennale mit Beuys ein anderes großes Vorbild persönlich kennengelernt hat. Es kann sein, daß Arnold Werner Bischof auf dem Bürgenstock getroffen hat, aber ob Arnold den Namen des Photographen vorher kannte... – wir werden es nie erfahren! Aber weil es sich gut anhört, wenn Arnold erzählt, glauben ihm die Journalisten. Und weil sie voneinander abschreiben, pardon, im Netz nach der Wahrheit googeln, reist diese Wahrheit durch die Welt. Ich will da nicht Störenfried sein: Wenn sie der Schwarmintelligenz so gefällt, wünsche ich der nachgereichten Biographie das beste. Aber das ist nicht so wichtig. Gute Kunst braucht keine Vita.
Matthias Dell führte das Gespräch mit Urs Odermatt am 15. November 2016 in den Räumen der Taurus Media Digital GmbH, München, anläßlich des Colour gradings von „Lopper“.
Aus: Arnold Odermatt –
Ein gutes Bild muß scharf sein!
Herausgegeben von Markus Hartmann
Hartmann Projects, Stuttgart 2017
Gefragt, was ein gutes Bild ausmache, gab Arnold Odermatt die lakonische Antwort, die zum Untertitel dieser ersten biographischen Publikation über seine Bilder und sein Leben wurde. „Ein gutes Bild muß scharf sein“ schließt eine Lücke in der Literatur über Arnold Odermatt, den Nidwaldner Polizisten, der als photographischer Autodidakt in der frühen Nachkriegszeit begann, Unfälle, den Polizeidienst, das alltägliche Leben und seine Familie mit seiner 6x6-Mittelformatkamera zu protokollieren.
Unbarmherzig durchbrechen die nüchtern-surrealistischen Unfallbilder die Idylle des familiären und beruflichen Lebens im Kanton Nidwalden. Die Texte von Daniel Blochwitz, Matthias Dell und Harald Szeemann interpretieren den Odermattschen Bildkosmos. Ausführlich wird die wundersame Entdeckung, die Erschließung und Verbreitung des Werks über Bücher, Medien, Ausstellungen und Galerien geschildert. Der Regisseur Urs Odermatt entdeckte 1991 die Bilder des Vaters bei Recherchen für den Spielfilm „Wachtmeister Zumbühl“, der Rest ist eine wunderbare, lehrreiche und unterhaltsame Geschichte über die Kunstwelt der letzten fünfundzwanzig Jahre.
Werner Götze
Lindemanns Buchhandlung, Stuttgart
*
Nach welchen Kriterien photographierten Sie?
Damals gab es keinen Unterschied zwischen Dienst und Nichtdienst. Die Grenzen waren fließend. War die Wache dicht, wurde der Notruf in unser Schlafzimmer umgeleitet. Kaum eine Nacht ohne Anruf. Hieß auch, war zwischen zwei Einsätzen Zeit für ein Bild, war dies zivil. Uniform hin oder her. Die Photographie war Strukturhilfe. Ich wußte immer – hier Dienstphoto, da Tagebuchphoto.
Ihr außergewöhnlichster Einsatz?
Ich mußte als photographierender Polizist mit schütterem Haar und langer Strähne zum Abdecken der Blöße einen photographierenden Polizisten mit schütterem Haar und langer Strähne zum Abdecken der Blöße photographieren – als Standphotograph bei Dreharbeiten: Michael Gwisdek als Wachtmeister Zumbühl im Spielfilm Wachtmeister Zumbühl. Das Ablichten der eigenen Gewohnheiten, Macken und Schrullen bei einem erfundenen, aber sehr authentischen Alter ego war schon sehr außergewöhnlich. Und gewöhnungsbedürftig.
Haben Sie im Archiv ein Lieblingsbild?
Bei 60’000 Negativen? Ich müßte würfeln. Aber es gibt Bilder, die sind definitiv nicht mein Lieblingsbild. Eines war ein Licht- und Schärfeübungsbild, Füller eines Dienstfilms, nie vergrößert und aus Versehen als Negativ aufbewahrt: Ein Selbstportrait mit nacktem Oberkörper vor dem Spiegel aus den fünfziger Jahren. Jetzt ist es das Titelbild der zweiten Auflage von In zivil. Mein Sohn, der Regisseur und Herausgeber Urs Odermatt, hat bei der Zusammenstellung meiner Arbeiten alle Rechte und einen Freibrief bekommen, den er virtuos und sehr frei nutzt!
Matthias Ackeret
„Das mit der Kunst ist mir noch nicht ganz klar“
Persönlich, Zürich, 12. Januar 2014
*
Sie werden fünfundneunzig. Wie geht es Ihnen?
Gut, danke. Ich habe jetzt Personal (eine Altenbetreuerin, die ihn viermal wöchentlich besucht, jm), eine Stoßkarre aus Norwegen, ein Modell – gebaut nur für Polizisten (wir mußten Arnold Odermatt den Rollator mit einer guten „Geschichte“ schmackhaft machen, uo), und meinen eigenen Dienstplan in den eigenen vier Wänden, ohne Wecker, Einsatztelephon, feste Eßzeiten und Vorgesetzten. Und beste Gesundheit, außer daß bei mir jetzt alle laut reden, groß schreiben und sich meine alten Anekdoten zweimal anhören müssen.
Wie feiern Sie den Geburtstag?
Anders als meinen Neunzigsten. Mein Galerist hatte mich damals zu einer kleinen Feier nach Berlin eingeladen, dann war es ein Empfang in der rammelvollen Galerie. Den Fünfundneunzigsten feiere ich ruhig zu Hause. Allerdings mit Video-„Tschätt“ nach Thüringen – meine Ausstellung in der Kunsthalle Erfurt wird an meinem Geburtstag das letzte Wochenende zu sehen sein. Nicht nur meine Photos sind in Erfurt ausgestellt, auch meine Kameras, die Laborsachen und meine Dunkelkammer. Mein Sohn und seine Partnerin müssen dafür sorgen, daß alles wieder heil nach Hause kommt.
Wie verbringen Sie diese verrückte Zeit?
Nicht die Zeit ist verrückt. Die Leute sind es. Will ich spazieren gehen, schicken mich Wildfremde wieder nach Hause. Will ich Käse kaufen, macht der Händler vor meiner Nase die Tür zu. Gaat’s nu? Ich will weder einrosten noch fasten, sondern meine alten Tage genießen. Ohne den Personenschutz durch meine Kinder wäre ich jetzt Knastbruder in meiner eigenen Wohnung. Warum? Ein Virus aus China? Ich habe noch keinen gesehen – wäre mir aufgefallen.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Da ist jede Antwort frech. Seit ich in den Ruhestand ging, gab es über hundert Ausstellungen auf allen Kontinenten, die vier Bücher, die mein Sohn bei Steidl in Göttingen gemacht hat, kann man in jedem Land der Welt in der Bibliothek anschauen, ich kann meinen Namen im Netz in allen Sprachen und Schriften sehen – und ich bin gesundheitlich fit wie ein altes Roß. Was soll ich mir noch für die Zukunft wünschen? Den Nobelpreis? Den gibt’s nicht für vierzig Jahre gute Polizeiarbeit.
Gibt es ein Lieblingsbild?
Das ist die häufigste Frage, die mir gestellt wird. Ich hätte längst eines aussuchen und die Wahl auswendig lernen sollen. Aber entscheiden Sie sich für ein Bild, wenn es sechzigtausend sind! Das Am-wenigsten-Lieblingsbild ist einfacher: Ich habe vor sechzig Jahren ein Schärfetestphoto gemacht und das Negativ in der Schublade vergessen: ich, vor dem Spiegel, mit nacktem Oberkörper – es war Sommer! Jetzt ist es stolzes Titelbild von In zivil. Mein Sohn, der Herausgeber, nutzt die Freiheiten, die er hat.
Gibt es einen besonderen Polizeieinsatz, an den Sie sich gern erinnern?
Das ist sehr, sehr lange her. Ich war abkommandiert auf den Bürgenstock: Personenschutz für Konrad Adenauer. Der deutsche Politiker nahm im Grand Hôtel an einer Konferenz teil und wollte vor Paparazzis geschützt werden. Mein Vorgesetzter hat meinen Einsatz am nächsten Tag schlechtgelaunt kritisiert – ich hätte selbst am meisten photographiert. Außerdem sollte der Kanzler personengeschützt werden. Nicht seine Tochter.
Gespräch mit Eliane Winiger
Keystone-SDA, Luzern, 15. Mai 2020
*
Happiest 95. Birthday and the very best wishes, dear Mr. Arnold Odermatt! Thank you for such a prolific while self-taught life-long pursuit of photography and your always curious, sometimes mischievous, unflinching, persistent and ever exacting practice! I feel honored to have had the opportuity to curate twice a solo exhibition of your wonderful work.
...und genießen Sie die kommenden fünf Jahre ‒ bevor wir dann auf Ihren hundertsten Geburtstag anstoßen.
Daniel Blochwitz
*
Arnold Odermatt, Switzerland’s coolest policeman, turns 95 today – in 2018 I had the honour to welcome him to visit his monumental outdoor photography installation: what an incredible photographer!
Stefano Stoll
Festival Images, Vevey
*
Der einzige Verriß – ein Heimspiel
Wie diesen Photos begegnen? Sind sie Kunst, Dokumentation, Zeugnis einer Obsession, die den Polizisten befallen hat, einfach makaberer Zeitvertreib? Ein klares Kunstwollen steht kaum, der Wille zur sachlichen Dokumentation möglicherweise hinter den Bildern. (...) Arnold Odermatt klammert den tragischen Hintergrund fast immer aus, oder er läßt ihn höchstens erahnen – am deutlichsten dort, wo ein zerbeultes Fahrrad auf der Straße liegt, wo sich an Spuren ablesen läßt, daß Kinder beteiligt waren.
(...) Dieser menschlich anrührenden Komponente der Odermattschen Karambolagebilder, welche je nach Disposition des Betrachters den eigentlichen Charakter eines barocken Memento mori – eines Gedenkens an den Tod – annehmen, steht jedoch der distanzschaffende und kunstgewerblich-biedere Ästhetisierungswille
des Photographen entgegen. Diese Ästhetisierung mag verhindern, daß uns die Bilder allzu nahe an die Tragik des Geschehens heranführen. Es gibt weder Leichen noch Verletzte noch Blut. So sind die drastisch-direkten Bilder des bekanntesten Polizeiphotographen, des Amerikaners Weegee (1899-1968), himmelweit entfernt. Odermatt pflegt das schöne Unfallbild, das Bild des Unfalls in schöner Landschaft. Oft scheint er verliebt ins schöne Detail der Zerstörung. Liebe kann blind machen.
Um Aufklärung, Erziehung oder Sensibilisierung geht es ihm kaum. Um kritische Ironie am Fetisch Mobilität, ein sarkastisches Ad-Absurdum-Führen moderner Zivilisationserrungenschaften oder eben ein Memento mori schon gar nicht. Nur schwer wird eine Absicht faßbar, die über die Bilder selbst hinausweist. (...)
Niklaus Oberholzer
Kunstgewerblich-bieder
Neue Luzerner Zeitung, 23. September 2003
*
(...) Odermatt is to car wrecks what Weegee was to human wrecks, but Odermatt was a better photographer, and his images paradoxically have more humanity in them than many of Weegee’s corrosive caricatures. These cars seem to be having trysts on wet highways beneath lowering clouds, or taking a dip in a placid lake on a foggy morning.
Philip Kennicott
The Washington Post, 1. November 2013
*
Arnold Odermatt freut sich, daß „nicht nur deutsche Zeitungen“ über seinen 95. Geburtstag berichten.
Arno Renggli
Nidwaldner Polizist schoß legendäre Photos
Luzerner Zeitung, 28. Mai 2020
*
Urs Odermatt
Arnold Odermatts Arbeiten stehen völlig für sich. Kein Kontext, kein Konzept, kein elitärer Kunstentschluß hat sie je gefickt.
Caroline Recher
Attends, je traduis ça comment?
Entretien avec Urs Odermatt
L’Été photographique de Lectoure
Lectoure (Gascogne)
*
Ein Polizist bleibt nicht ohne Ärger. Dreimal mußte ich vor Gericht erscheinen, wegen „schwerer Körperverletzung“, wegen „Überfahrens einer Frau“ und wegen „Rückwärtsgeisterfahrt auf der Autobahn“. Die Verfahren endeten mit Freispruch und Gegenklagen wegen Verleumdung. Auch eine Posträuberverfolgung mißlang – trotz Blaulichts hatte der DKW eine Motorpanne.
Arnold Odermatt
42 ½ Jahre Polizist Noldi Odermatt
Kantonspolizei Nidwalden, Stans, 1990
*
Ein kluger, reflektierender Mensch war Odermatt, gewiß kein einfacher, das wird in den Interviews deutlich, in denen er selbstironisch über sich selbst spricht. Spitzzüngig, mit einem Talent für kabarettistische Formulierungen. Wer weiß, vielleicht schlummert in seinen Unfallprotokollen ein literarischer Schatz?
Frank B. Meyer
Er gab dem Chaos Perfektion
Auto Bild Klassik, Hamburg, 9/2021
Ging da jemand der Sprachmacht des Herausgebers auf dem Leim?
Jasmin Morgan
*
Ein klassisches Zeitreisemotiv: Ideell als Unangepaßter und qua Amtes als Deserteur von ihm verfolgt, reist der Sohn in die Vergangenheit und erschafft den Vater neu. Dessen spätere Entdeckung schmiedet die Arbeitskomplizenschaft zweier Künstler, die den Vater berühmt und den Sohn unabhängig macht.
Michael Birkner
Dramaturg, Lübeck
