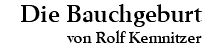In Neoprenanzügen waten die Schauspieler im Wasser und robben durch den Schlamm – ein Szenario, das zugleich Aufbruchs- und Endzeitstimmung verheißt. Eine Art Ursuppe, in der sich die Protagonisten einer überkommenen Zivilisation an den Ausgangspunkt der Evolution zurückbegeben. Urs Odermatt inszeniert in Saarbrückens Alter Feuerwache Rolf Kemnitzers Stück Die Bauchgeburt, eine Uraufführung. Am heutigen Samstagabend ist Première. Das Stück spielt in einer Welt, in der sich die Menschen nach einer Katastrophe nur noch über das Medium Internet austauschen und auch die Fortpflanzung ein völlig virtueller Vorgang ist. Die körperliche und sprachliche Kommunikation ist gestört; das unerhörte Phänomen einer natürlichen Schwangerschaft, einer Bauchgeburt also, wird exhibitionistisch im World Wide Web vermarktet. Odermatt, der sowohl für Bühne als auch für Film Regie führt, arbeitet mit völlig unterschiedlichen Methoden. Als Filmregisseur um Illusion bemüht, sucht er im Theater das Gegenteil: „Die Behauptung, die Abstraktion, die Reduktion“, wie er uns in einem Gespräch verrät. Für seinen formalen Ansatz reizt ihn gerade an Kemnitzers Stück das Potenzial des Texts: eine Spielknetmasse, bei der jeder Satz zu phantasievollen Assoziationsketten herausfordere. Zwar hat Odermatt kein einziges Wort gestrichen, doch geht er mit dem Sprachmaterial frei um: Für chorisches Arbeiten etwa muß der Text anders aufgeteilt werden. Keine leichte Aufgabe für die fünf Schauspieler, wie der Probenbesuch zeigt. Ganze Passagen werden da parallel skandiert, gegenseitig werden Satzfragmente ergänzt oder Lieder verkompliziert, indem immer wieder Worte ausgelassen werden. Sogar körperliche Funktionen werden ausgetauscht, wenn etwa ein Akteur für den anderen die Gestik übernimmt.
Entsprechend komplex ist die Rollenverteilung, denn Odermatt unterläuft die Illusion auch dadurch, daß er seine Schauspieler fiktive Biographien entwickeln läßt. Dieser Kunstgriff des „Theaters im Theater“ unterstreicht: Hier wird nur gespielt. Gezielt nutzt Odermatt diese „Zwischenrollen“ als Basis, auf der die Akteure Konflikte austragen. Indem nämlich ihre „wahre“ Persönlichkeit, etwa in sprachlichen Eigenheiten, zu Tage tritt: Akzent, Dialekt und Soziolekt oder einfach nur Stimmfärbung. Einen zusätzlichen Verfremdungseffekt gewinnt Odermatt dadurch, daß er weitgehend requisitenfrei arbeitet. Wenn das Textbuch Requisiten verlangt, dann werden sie erspielt. Oder auch vom Publikum eingefordert: Wer in der ersten Reihe sitzt, darf sich also auf einiges gefaßt machen.
Das alles klingt sehr theoretisch, doch dürfte die Aufführung eher spannend als kopflastig werden. Wozu wohl maßgeblich die intensive körperliche Umsetzung beitragen wird: „Vom Zuschauer ist vor allem Konzentration gefordert, weil der Abend ein sehr schnelles Tempo hat“, erläutert der Regisseur. Und Urs Odermatt verspricht, daß auch die Unterhaltung nicht zu kurz kommen wird, weil „durch den entschiedenen Griff in die Kiste des Spaßes und der großen Effekte dem Zuschauer auch sehr viele Dinge serviert werden, die eine schnelle Komik entwickeln.“ Na dann – auf in die Schlammschlacht zwischen Kolportage und Raffinesse.
Kerstin Krämer
Ab in die Ursuppe – vor der Saarbrücker Uraufführung: Blick auf „Die Bauchgeburt“
Saarbrücker Zeitung, 2. März 2002
*
Herr Odermatt, Sie sind Film- und Theaterregisseur. Wo liegt für Sie der Unterschied einen Film zu drehen oder ein Theaterstück zu inszenieren?
Drehbücher lese ich völlig anders als Stücke. Drehbücher prüfe ich auf ihre inhaltliche, dramatische und psychologische Schlüssigkeit, weil ich später in der Umsetzung zu einem Film eine für das Publikum glaubwürdige Illusion herstellen und wegen des hohen Produktionstempos auf dem Drehort fast alle kreativen Entscheide schon in der Vorbereitungsphase treffen muß.
Ich arbeite als Regisseur etwa gleich oft für die Bühne und für die Kamera. Dieser stete Wechsel zwischen Film und Theater hat etwas ungemein befruchtendes und ist ein gutes Rezept gegen lähmende Routine; es würde mir sehr schwerfallen, mich für die eine oder die andere Arbeit zu entscheiden. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, daß mich beim Theater etwas völlig anderes interessiert als beim Film. Im Theater geht es mir nicht um Illusion und Suggestion, um den berühmten Rampensprung; die Leute sind nicht angehalten, zu vergessen, daß sie in einer Vorstellung sitzen. Auf der Bühne interessieren mich vielmehr die sehr theaternahen Konzepte der Behauptung, der strengen Form, der Abstraktion und der Reduktion, dies selbstverständlich nicht, ohne das sehr legitime Bedürfnis des Zuschauers zu vergessen, sich nicht zu langweilen.
Können Sie sich noch an die Bilder erinnern, die Sie im Kopf hatten, nachdem Sie „Die Bauchgeburt“ zum ersten Mal gelesen haben?
Ein Stück lese ich weniger auf Inhalt und Psychologie; ich versuche vielmehr, herauszufinden, ob der Text in reichem Maße Spielknetmasse für die Schauspieler bietet, und ob er Material für den Beginn einer Assoziationskette für die spätere Probenarbeit verspricht, bei welcher ich dank der privilegierten Zeitreserven bei der Theaterarbeit meine Inszenierungen entstehen lassen kann. Sich im Nachhinein daran zu erinnern, was der Anfang dieser Assoziationskette war, ist nicht einfach. Ich würde mich in einem Feld von Erinnerungsbruchstücken und Spekulationen bewegen.
Zwei archaische Elemente bestimmen das Bühnenbild: Wasser und Schlamm. Dazu kommt das moderne Element einer Spiegelprojektionswand.
Das Stück vermittelt eine Endzeitstimmung. Da ich das Stück in Berlin gelesen habe, und man dort wunderbar von Baustelle zu Baustelle tapsen kann, haben sich die um den Stoff kreisenden Bilder und Chiffren bald auf die Elemente Wasser und Schlamm verdichtet, ganz einfach, weil man weite Teile der Stadt nur in Stiefeln besuchen kann. Vielleicht ist dies ein gutes Beispiel dafür, zu erklären, wie schmal der Grat zwischen schelmischer Willkür und stimmigen, inspirierten Assoziationen sein kann, die sich aus dem Text heraus ergeben. Wenn ich das Stück anderswo gelesen hätte, wäre das Bühnenbild möglicherweise ganz anders geworden. Zum Glück habe ich im Sommer keinen Schlachthof besucht, sonst würden wir wohl auf Tiermehl spielen.
Die Endzeit des Autors schließt den Kreis zu der Zeit vor der Zivilisation: Recht ist das Recht des Stärkeren. Fressen oder Gefressen werden. Wer hier vorschnell von früh- oder spätfaschistoiden Verhaltensformen spricht, vergißt, daß auch in einer Demokratie der Stärkere, die Mehrheit, diktiert. Außer man regelt die Welt so basisdemokratisch wie in der Schweiz, wo die Minderheit mit den Privilegien der Verweigerung ausgestattet ist, der Mehrheit diktiert und das Land in die (durchaus wohlhabende) Stagnation stürzt. Wie man’s macht, macht man’s falsch.
Sie lassen das Baby, das eigentlich erst am Ende des Stücks auftritt, von allem Anfang an mitspielen.
Ich habe den Titel des Stückes nicht auf Anhieb verstanden. Als der Groschen schließlich gefallen war, habe ich gemerkt, daß das ungeborene Baby die heimliche Hauptrolle ist. Es geht in der Geschichte um das umgekehrte Paradoxon in einer zukünftigen Gesellschaft, daß ein Kind nicht, wie es sich eigentlich gehört, im Labor, sondern in unschicklicher Weise aus einem Bauch geboren wird. Da gehört das Ungeborene natürlich von Anfang an auf die Bühne, weil es wenig Sinn macht, über die Hauptperson fast den ganzen Abend nur zu sprechen. Damit der Autor sich nicht mißverstanden fühlt, ist das Baby aber so chiffriert, daß der Zuschauer eine ganze Weile braucht, um die Annahme zu lesen.
Ich setze ganz gerne zwischen die Schauspieler und die Figuren, die sie spielen, noch eine Zwischenebene: In der ersten Probenphase ermuntere ich die Schauspieler, Schauspieler zu spielen, die die Rolle und das Stück geben. Dies eröffnet reiche Spielmöglichkeiten, weil so die tausend Tücken, die den Schauspielern in der Probenarbeit das Leben schwer machen können, Teil des assoziativen Findungsprozesses werden. Manchmal überlebt diese Zwischenstufe in der Inszenierung und überrascht die Zuschauer mit unerwarteten Aussteigern, manchmal bleibt sie bloß Teil des Probenprozesses. Bei dem Schauspieler, der in diesem Stück das Baby spielt, wird die Sache noch komplexer, weil es hier viele Figuren von komparsenhafter Größe gibt, die ihm auch noch mitgegeben wurden. Bei Rolf Kemnitzer erscheinen diese Figuren als Filmeinspielungen per Monitor, ich dagegen habe mich dazu entschlossen, diese Figuren und konsequenterweise auch die Rolle des Monitors auf die Schauspieler zu verteilen, in erster Linie auf den Schauspieler, der das Baby spielt.
Sie haben festgelegt, daß die Schauspieler von allem Anfang an auf der Bühne präsent sind. Meiner Meinung nach wollte der Autor zeigen, daß die Figuren in seinem Stück in ihrem sozialen Verhalten stark verkümmert sind. Deshalb steigen sie auch immer wieder aus den Beziehungen aus, um dann unvermittelt wieder aufzutauchen. Bei Rolf Kemnitzer verschwinden sie, bei Ihnen bleiben sie auf der Bühne und doch entsteht der gleiche Eindruck: Die Menschen halten das Miteinander nicht mehr aus. Wenn sie aussteigen, dann hat man das Gefühl, sie schalten sich ab und werden völlig teilnahmslos.
Es ist durchaus Teil meiner Arbeitsweise, mit ganz wenigen oder gar keinen Requisiten zu spielen. Verlangt der Text des Autors oder die Inszenierung nach einer Kettensäge, dann spielt ein Schauspieler diese Kettensäge. Das gleiche Prinzip des Weglassens läßt sich auch bei den Abgängen und den Auftritten anwenden: Zum einen kommen die Schauspieler kaum zu Abgängen, weil es oft noch Hunde und Katzen gibt, die über die Bühne strolchen, und dafür braucht es Personal. Wenn das Textbuch auf einem Abgang besteht, geht der Schauspieler dennoch nicht zwingend ab, sondern er behauptet den Abgang, das heißt, er spielt, er sei abgegangen, und er sei nicht mehr zu sehen. Er knipst sich selbst aus wie ein selbstbestimmtes Fernsehgerät; das Gerät ist noch zu sehen, das Programm nicht mehr. Dieses Mittel der Behauptung ist ein wunderbares Privileg des Theaters, etwas Ähnliches gibt es beim Film nicht.
Holger Schröder
Gespräch mit Urs Odermatt, Programmheft zur Uraufführung
Saarländisches Staatstheater, Saarbrücken 2002
*
Der 1955 in Stans, Schweiz, geborene Urs Odermatt ist Theaterautor, schreibt Drehbücher und hat erfolgreich ein Buch mit Photographien seines Vaters herausgegeben; in erster Linie arbeitet er als Regisseur für das Theater sowie für Film und Fernsehen. Zurzeit steckt er mitten in der Probenarbeit für die Uraufführung von Rolf Kemnitzers Die Bauchgeburt. Bei seiner Film- beziehungsweise Theaterarbeit geht er von ganz unterschiedlichen Prämissen aus: „Wenn ich einen Film drehe, dann arbeite ich mit dem Mittel der Illusion, natürlich auch unter Nutzung der ganzen technischen Möglichkeiten, die man im Film einsetzen kann.“ Am Theater interessiert ihn dagegen die pure Behauptung. In der Probe ist alles erlaubt außer der Frage „Warum?“. Durch das Zulassen extremer formaler Möglichkeiten entwickelt sich auf einer intuitiven Ebene ein psychologisches Fundament für die Figuren.
Odermatt ist als Autodidakt zur Regie gekommen. Er hat nie assistiert oder eine Regieschule besucht. Angefangen hat er als Journalist, doch sein Hang zur Fiktion sei stärker gewesen als die Verpflichtung zum Faktischen. So begann er, Filme zu drehen und wurde Meisterschüler bei Krzysztof Kieślowski und Edward Żebrowski; die Ausbildung bei seinen beiden Lehrmeistern endete mit der dramaturgischen und filmtheoretischen Begleitung seines Spielfilms Wachtmeister Zumbühl aus dem Jahre 1993 (mit Michael Gwisdek, Jürgen Vogel, Anica Dobra und Rolf Hoppe). Zurzeit arbeitet Odermatt an einigen Filmprojekten nach eigenen Drehbüchern, die er als Mitbegründer der Nordwest Film AG auch selbst produzieren will.
H.S. (Holger Schröder)
Drei Männer im Schnee... –
die Regisseure Urs Odermatt und Stephan Suschke und der Videokünstler Oliver Most zu Gast in Saarbrücken
„Theaterzeit“, Saarländisches Staatstheater Saarbrücken, Februar 2002


Vor der Vorstellung: Alle Mitwirkenden schütteln mir die Hand. Dem Autor. Sie lächeln, aber dieses Lächeln ist irgendwie verdächtig. „Jedenfalls habe ich keine Zeile des Texts gestrichen“, sagt der Regisseur und lächelt ebenfalls. Dieses „jedenfalls“ geht mir nicht aus dem Ohr. Ich höre es immer wieder.
Dramatikerkollegen warnen mich. Viele von ihnen gehen schon lange nicht mehr zu ihren Uraufführungen und Premièren, manche empfinden jedes Theater von innen als eine Zumutung und schreiben, nehme ich an, nur noch aus Gewohnheit für die Bühne oder um sich selbst Spaß zu machen. Im Programmheft sagt der Regisseur etwas vom Text als Spielknetmasse und daß ihn Illusionen auf der Bühne nicht interessieren. Vielleicht ist mein Schreiben für die Bühne auch eine Illusion. An der Bar im Foyer schlucke ich zwei Viertel Wein.
„Die Geburt steht bevor“, sagt der Intendant vor dem Zuschauerraum. „Ich habe noch gar keine Schmerzen“, sage ich ahnungsvoll. Der Leiter der Theater AG aus meiner ehemaligen Schule taucht auf und spendiert mir ein Viertel Wein. Für ihn habe ich mein erstes Stück geschrieben: Schneewittchen und die sieben Kosmetikerinnen. Er ist ein Anhänger absoluter Texttreue. Ich keineswegs.
Das Licht geht aus. Ein Stück beginnt. Ich erkenne meine Dialoge wieder, unter anderem. Zwar werden keine Situationen hergestellt, keine psychologischen Beziehungen entwickelt, keine Charaktere dargestellt, doch stellt die Inszenierung so etwas wie den inneren Raum der Welt dar, in der das Stück spielt. Es geht um die Seele des Texts, nicht aber um seine Gestalt. Die Geschichte, die erzählt wird, kann der Zuschauer nur erahnen.
Ein Jahr habe ich geschrieben, eine Fassung nach der anderen überarbeitet, bin manchmal nachts aufgestanden, um zwei Wörter zu verändern. Nachts hört man besser, und man schreibt ja als Theaterautor wie ein Tauber, der sich Musik vorstellt.
Zwei Wochen vor der Première fragte ich nach dem Stand der Proben. Der Dramaturg mailte, das Haus arbeite am Rande seiner Belastbarkeit. Immerhin etwas, dachte ich. Die Schauspieler, mailte er weiter, brächten auch eigene biographische Texte ein. Neben den Beziehungen der Stückfiguren würden die Beziehungen der Schauspieler untereinander dargestellt. Er hätte schreiben sollen: statt. Ich verstehe, daß Psychologie den Regisseur ankotzt. Zuschauer, die etwas verstehen wollen, kotzen ihn an. Ich verstehe ihn gut. Vielleicht ist er mit seiner Inszenierung einen Schritt weiter gegangen als mein Text. Ich zeige darin das Verschwinden des Menschlichen. Bei ihm ist es schon verschwunden.
Seine künstlerische Radikalität stellt er über mein traditionelles Konzept der Menschendarstellung, oder sagen wir: der Darstellung von Restmenschen. So was scheint ihm banal zu sein – er setzt eine Art Bewegungscodes dagegen, Wiederholung, Rhythmisierung und symbolische Aktionen. Manchmal ist dieser ganz eigene Stil ätzend scharf und macht mir etwas klar über mein eigenes Stück, manchmal wird es banal und langweilig. Ebenso die Abschweifungen der Schauspieler in kabarettistische Nummern: manchmal erhellt das die Figur, die sie sprechen, manchmal möchte man vorspulen.
Ich verstehe auch den Leiter meiner Theater AG, der nur noch wissen will, ob es auf der Premièrenfeier genug Freibier gäbe. Beerdigungsfeier, denke ich. Der Intendant sagt, wir hätten ein Werk vom Ausmaß einer griechischen Tragödie gesehen, auch wenn er zu alt sei, um von solchen Stücken etwas zu verstehen. Daß ich mit der Inszenierung Probleme haben könnte, kommt ihm gar nicht in den Sinn. Er wiederholt immer wieder, daß er zu alt sei, und ich ahne, daß er froh darum ist.
Spät in der Nacht sagt einer der Schauspieler, Marlene Streeruwitz hätte so eine Uraufführung mittendrin unterbrochen, wäre ein Text von ihr auf diese Weise ins Wasser gefallen. Mit einem Text von Marlene Streeruwitz hätte man das nicht gemacht, sagte ich, und ich zweifle auch schon daran. Ein Zuschauer, der den Text nicht kennt, hätte die Handlung nicht verfolgen können, bemerke ich gegenüber dem Regisseur, der mit mir höflich anstößt. Dieses Verfolgenwollen sei etwas sehr deutsches, antwortet er. Er ist Schweizer.
Zurück an meinem Schreibtisch habe ich keine Lust, an meinem neuen Text weiterzuschreiben. Dem Gefühl, fremd zu sein in meinem eigenen Leben, das ich mit Schreiben so oft erfolgreich bekämpft habe, kann ich nichts entgegensetzen.
„Es ist alles so sinnlos.“ Wenn ein Mann auf der Bühne diesen Satz sagt, gar wiederholt, finde ich das ein bißchen peinlich. In meinem Text sagt diesen Satz ein Baby im Kinderwagen.
Rolf Kemnitzer
Programmheft 2 / April 2002
Verlag der Autoren, Frankfurt am Main