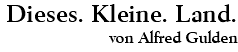Es ist nicht nur kein Schlüsselstück über Zustände im Saarland, es ist überhaupt kein gutes Stück. Nur höflichen Applaus gab es für die Uraufführung von Alfred Guldens Dieses. Kleine. Land. am Freitag in der Alten Feuerwache. Auch Urs Odermatts überaus einfallsreiche Regie und das glänzend agierende Ensemble konnten nichts mehr retten.
Um von vorneherein mit einer irrigen Vorstellung aufzuräumen, die womöglich auch die Herren Lafontaine, Klimmt und Maas in diese Uraufführung drängte: Alfred Guldens Stück Dieses. Kleine. Land. ist – bewußt, so Gulden – kein Schlüsselstück über dieses kleine Land Saarland. Obschon als Auftragswerk des Staatstheaters aus Anlaß der Saarabstimmung vor fünfzig Jahren konzipiert, hat Gulden – von jeher der Region wie kein anderer Autor in produktiver Haßliebe verbunden – seiner Heimat darin keinen Spiegel vorgehalten. Guldens verunglückte Groteske in dieser Weise umdeuten zu wollen, führt ins Leere. Der Spiegel bleibt blind. Insoweit provoziert Dieses. Kleine. Land. gerade nicht jene „schmerzhafte Standortbestimmung“, die Karl Richter (im Nachwort des Textbuchs) darin auszumachen meint. Dazu leidet das Stück zu sehr an Überkonstruiertheiten und einer holzschnittartigen Psychologie. Was in bemerkenswertem Gegensatz zur sprachlichen Versiertheit des Stücks, seiner Musikalität, steht.
Daß die Verbundenheit mit einem Landstrich Gefahr läuft, in der Sackgasse Provinzialismus zu enden oder von modernen Kreuzrittern der Globalisierungspolitik eliminiert zu werden, ist Grundidee des Stücks. Ein Entweder-Oder-Prinzip, das keinen Platz für Differenzierung läßt. Die Plausibilität seiner Charaktere opfert Gulden denn auch zugunsten krasser Überzeichnung.
Ein entstellter, vermögender Erfinder, „ein Stück Fleisch in einem Rollstuhl“, will mittels skandalträchtiger Aktionen, für die er einen in Vergessenheit geratenen Dichter anheuert, und einer Untergrundbewegung den Ausverkauf seines Landes verhindern. Sein „Widersacher“, der in eine einflußreiche Bankerfamilie eingeheiratet hat, setzt umgekehrt Regionalismus mit Engstirnigkeit gleich und betrachtet das Land als Verfügungsmasse in einem großen Profitspiel. Als der „Chef“ seinen Intimfeind durch ein Sadomasovideo, in dem dieser sich zu einem grunzenden Schwein erniedrigt, in der Hand hat, wechselt der Erpresste im Handumdrehen die Seiten. Fortan markiert er den Lokalpatrioten. Beide, den Überzeugungen wie Kleider wechselnden „Widersacher“ – herausragend: der gazellenartige Marcel Bausch, der virtuos auch noch einen Fußballpräsidenten, Intendanten, Filialleiter, Kultusminister Schreier und, und, und gibt – wie den seine Umgebung wie Marionetten dirigierenden „Chef“ (Dämon und Wurm in einem: Michael Hiller), zeichnet Guldens Stück als Prototypen heutiger Politiker. Also ist der Kampf um dieses kleine Land gewissermaßen eine Miniversion von Troja, das ohne die schöne Helena nicht denkbar wäre. Weil der „Chef“ damals seine heutige Gattin (Ulrike Walther) eroberte, die auch sein alter Rivale umwarb, bekämpft dieser seither alles, was sein alter Nebenbuhler will.
Wären Guldens Figuren plausibler gestaltet, hätte die Herleitung öffentlicher Rollen aus privaten Beschädigungen das Stück am Ende womöglich erden können. Regisseur Urs Odermatt zerlegt dieses mit einigem Gewinn in seine Bestandteile, erfindet Szenen hinzu, läßt andere weg (Bühne und Kostüme: Dirk Seesemann). Und ignoriert die darin intendierten Videosequenzen, indem er, was im Stück Filmeinspielungen sind, laut- und szenenmalerisch spielen läßt. Wobei sich für Momente, wenn man die Guerillagruppe einer ehemaligen Sowjetrepublik zu erahnen glaubt, auch Beklemmung entsteht. Weil es hier dann mit einem Mal existenziell wird.
Nicht nur das Stück wird zerlegt und neu montiert, sondern auch dessen Figuren und deren Sprache. Sätze fallen immer wieder wie Kartenhäuser zusammen, aus deren Trümmern neue Fassaden erstehen. Alles wird bei Odermatt zum Zitat im Zitat, weshalb Schlagerrefrains angesungen, Worte wie Vinylplatten gescratcht und Szenen (wie von Gulden ausdrücklich angelegt) als Spiel im Spiel laufen. Immer wieder entsteht so ein mal chorisches, mal konzertiertes Sprechen, dessen Dialogstimmen sich über- und zerschneiden. Ein dekonstruktivistisches Verfahren, das Pantomime mit Slapstick und absurdes Theater mit konkreter Poesie mischt.
Eine ganze Weile lang vermag dieses von Odermatt ganz ähnlich vor drei Jahren bei der Saarbrücker Uraufführung von Rolf Kemnitzers Die Bauchgeburt erprobte Zerlegungsritual zu fesseln und die dialogischen Qualitäten von Guldens Stück freizulegen. Quer durch die Feuerwache: Odermatt verbannt sinnfällig Guldens innerlich zerrissenen „Dichter“ (Maximilian Wigger) während des zweistündigen Abends in die letzte Publikumsreihe. Irgendwann aber beginnt auch Odermatts Einfallsfeuerwerk zu verglühen und sich zu wiederholen. Was bleibt, ist mitunter hochklassiges Schauspielertheater (in den weiteren Rollen: René Schack und Jörg-Heinrich Benthien. Urs Fabian Winiger, Kathrin Aebischer). Nur: Am Ende dieses Stücks ohne wirkliches Ende wissen wir nicht mehr über die inneren Befindlichkeiten welchen kleinen Landes auch immer. Reichlich verhalten war denn auch der Applaus.
Christoph Schreiner
Der Spiegel fürs Saarland bleibt blind – Lokalpatrioten und eine Miniversion von Troja
Saarbrücker Zeitung, 21. November 2005
*
Herr Gulden, Sie haben während der Arbeit an Ihrem Stück gesagt, Theater sei für Sie eine Rückkehr zur Körperlichkeit. Inwiefern?
Mich hat es interessiert, nach dreißig Jahren Fernsehen, Dokumentarfilm, also dreißig Jahren, in denen ich mich in den Hirnwindungen anderer bewegt habe und das wiedergegeben habe im Film, sozusagen indirekt, virtuell, da hat es mich wieder interessiert, daß Menschen leibhaftig da sind, daß Sprache tatsächlich passiert durch Menschen auf der Bühne. Daß da jemand sitzt, wie er sitzt oder geht, daß da jemand spricht, wie er spricht oder sich verspricht. Ich hatte zeitweise, das sage ich ungebrochen, einen Ekel vor dem Theater, vor diesem Moment der Körperlichkeit, ich sag’s mal in Anführungszeichen – „dieser Lüge“. Inzwischen ist mir klar, daß der Fehler oder die Lüge genau das Menschliche ist, was mich am meisten interessiert.
Sie haben diese Auftragsarbeit für das Saarländische Staatstheater im Herbst 2003 angenommen und zu diesem Zeitpunkt hatten Sie überlegt, eine Art historische Revue zu schreiben. Was war das für eine Ausgangsidee und wann haben Sie begonnen, das Stück in eine andere Richtung zu entwickeln?
Ich hatte erst an ein Stück über dieses kleine Land gedacht, in dem wir uns befinden. Die Auftragsarbeit kam ja nicht vom Himmel: 2007 haben wir fünfzig Jahre Bundesland Saarland, und das Theater brauchte etwas, um die Geschichte des Saarlands irgendwie darzustellen. Aber ich bin immer weiter vom Historischen, also vom Saarland als Saargeschichte, weggekommen, und mich hat viel mehr Interessiert, wie Identität, wie Heimat mißbraucht werden kann, wie mißbrauchbar diese Begriffe sind. Wer will, kann das Stück auf das Saarland beziehen, es könnte genauso gut auch Montenegro sein oder Tschetschenien. Es geht um das Modell eines kleinen Landes. Das soll aufgelöst werden. Und dann passiert dort etwas. Wir haben es in Deutschland erlebt, als Berlin und Brandenburg fusionieren sollten. Die Leute wollten das nicht. Es stellt sich immer die Frage: wieviel gewinnt man, wieviel verliert man. Was wollen die Leute heute überhaupt noch? Es geht darum: wozu lebt man, und nicht nur: wovon lebt man?
Jedes Sujet fordert eine bestimmte Form. Offenbar war die Form der historischen Revue Ihnen für dieses Thema, für das, was Sie ausdrücken wollten, nicht interessant genug. Sie haben eine Groteske geschrieben.
Ja, weil es grotesk ist, weil es nicht simpel abzubilden ist. Wenn ich hier im Saarland gehört habe, daß auf der einen Seite die Auflösung des Saarlands in ein Größeres propagiert wird und gesagt wird, dann hätte man mehr davon – wovon, weiß ich nicht –, und daß auf der anderen Seite Leute sagten, wenn das Saarland aufgelöst wird – und das war für die kein Witz –, dann werden sie kämpfen, in den Untergrund gehen, also quasi irische oder baskische Zustände im Saarland schaffen, das kann man doch nur wie bei den Abderiten oder mit der Groteske darstellen. Das geht gar nicht anders. Ich habe die Groteske gewählt, weil da Übertreibungen möglich sind, die der Wahrheit sehr viel näher kommen. Einer meiner Grundsätze ist: es ist alles da, nur viel schlimmer. Ich brauche nichts zu erfinden. Das ist auch die Grundlage für dieses Stück.
Was ist das zentrale Thema Ihres Stücks?
Ich sage ein paar Stichworte, die mir zentral vorkommen. Das eine ist „Identität“. Für mich gibt es nicht dieses krachlederne „Mia-san-mia-Gefühl“, und alles andere ist einem fremd, da muß man sich wehren, eine Festung bauen, sondern Identität hat für mich mit kritischer Distanz zu tun. Es dürfte den Saarländern klar sein, daß wir immer in einer Zwar-Aber-Situation gelebt haben, in einer Grenzsituation. Meine Mutter hat stets gesagt, „of däa anna Sait“ (auf der anderen Seite), wenn ich etwas argumentiert habe, sie wollte die Gegenseite wissen, wie denkt der andere, was ist „of däa anna Sait“ – das ist es, was für mich Identität ausmacht. Eine geistige Monokultur interessiert mich nicht, mich interessiert das Zwar-Aber, das Einerseits-Andererseits. Man sieht im Stück, wie sehr Identität mißbrauchbar ist, wenn sie simpel ist. Das andere, das mich im Stück gereizt hat, ist der Egoismus der Macht. Mir sagte vor kurzem ein Politiker, als ich mutmaßte, Politiker, das sei doch siebzig Prozent Eitelkeit, Narzissmus, Geltungsdrang: „Siebzig Prozent? – Fünfundneunzig Prozent!“ Damit hatte ich nicht gerechnet. Und wieder sind wir bei der Realgroteske. Man glaubt nicht, wie weit der Mensch in seiner Eitelkeit, in seinem Egoismus da involviert ist. Im Stück kommt der Satz vor: „L’etat, c’est moi, ich bin der Staat, und was ihr mir antut, das tut ihr dem Staat an.“
Sie führen in Ihrem Stück politisches Handeln auf ganz konkrete, persönliche Grundimpulse zurück.
Politisches Handeln ist nicht zu trennen von Menschlichem. Wir leben in keinem Computerstaat – es sind Menschen, die Politik machen; je höher die Sphären, desto verrückter wird es, die Politiker gehen zu Wahrsagern und Kartenlesern. Je größer die Macht, desto wahnsinniger wird es im Menschlichen.
Wir kommen auf das Thema zurück. Ich möchte nach Ihrer Arbeitsweise fragen. Es gibt Autoren, die sich auf das weiße Papier stürzen und kontinuierlich vorarbeiten. Sie sind jemand, so habe ich beobachtet, der über längere Zeit mit Notizbüchern arbeitet, Material sammelt, Figuren skizziert, Szenen entwirft, die Geschichte entwickelt. Die sprachliche Ausarbeitung kam erst ganz am Schluß.
Es ist so, daß ich in den Zeiten, in denen ich Dokumentarfilme gemacht habe, nicht an anderem arbeiten konnte. Vielleicht gibt es Leute, die einen Film machen und parallel einen Roman schreiben können. Ich kann das nicht. Wenn ich eine Idee zu einem Roman, einer Erzählung, einem Stück hatte, habe ich Notizen gemacht, das ging, derweil wir im Hotelzimmer saßen, abends. Ich habe Materialienbücher gefüllt, und wenn das Faß voll war, habe ich geschaut, daß soviel Geld da war, daß ich eine Zeitlang en bloc schreiben konnte. Das lief dreißig Jahre so. Ich kann nicht sagen, daß ich die Autoren, die nur geschrieben haben, beneidet hätte, denn das Drehen war für mich sehr wichtig. Wenn man so über Jahre arbeitet, geht einem das in Fleisch und Blut über. Bis heute arbeite ich von den Notizen, handgeschrieben, über die Materialienbücher, die sich füllen, bis hin zum Anfang des tatsächlichen Schreibens.
Sie sagten, in Ihrem Stück gehe es um die Mißbrauchbarkeit von „Identität“, „Heimat“. Im Aufsatz „Jeder hat sein Nest im Kopf“ haben Sie den Satz geschrieben: „Das Bedürfnis nach kleinen Heimaten ist groß“. Warum der Plural „Heimaten“?
Die Sammlung mit Aufsätzen ist Anfang der achtziger Jahre erschienen. Ab den siebziger Jahren gab es die Bestrebung, den Begriff „Heimat“ zu erneuern, der in der Nazizeit, aber auch in den fünfziger Jahren – schaut man sich Filme aus der Adenauerzeit an – mißbraucht und verkitscht worden ist. Da wollte ich sagen: Es gibt sehr wohl eine Sehnsucht nach etwas, wo man hingehört, wo man herkommt, und wo man sich wohlfühlt. Man versucht immer, sich kleine Heimaten zu schaffen. Das kann eine Straße sein in irgendeiner Stadt. Heimat ist für mich eine Sehnsucht, keine Erfüllung, die an einen bestimmten Ort gebunden ist. Es kann sich überall ergeben, daß etwas zu einer kleinen Heimat wird. Gestern fragte mich ein kleines Mädchen: „Ihr habt zwei Wohnungen?“ „Ja“, habe ich gesagt, „hier und in München.“ Da kam der Satz: „Und wo bist du lieber?“ Also wird sofort nach dem einen Ort gefragt. Ich sage immer, ich fahre von zuhaus’ nach Haus’. Das ist für viele schwer nachvollziehbar, aber den fremden, auch aufgeregten Blick könnte ich nicht haben, wenn ich nicht auch weg könnte, nicht bloß in Urlaub, Ferien wegfahren, sondern an mindestens zwei Orten leben, hier genauso wie dort.
Ich finde ein Photo aus Ihren Materialien interessant, auf dem eine Frau auf einem Mann reitet, wie es in der Sadomasoszene zwischen der Aktivistin und dem Widersacher im Stück geschieht. Dieses harmlose Photo aus einer Zeitschrift haben sie mit einem Stift bearbeitet und grotesk entstellt. Was wollten Sie hineinzeichnen oder hervorkehren?
Ich kann nicht zeichnen, aber in Übermalen bin ich gut. (lacht) Das Bild zeigt, daß ich nichts erfinden kann, es ist alles viel schlimmer. (lacht) In jedem Menschen steckt alles Mögliche. So steckt in jeder Macht das Gegenteil, nämlich die Ohnmacht. In jedem Sadisten steckt im Umkehrschluß ein Masochist. In der Figur des Widersachers, die nach außen die Macht verkörpert, steckt das Moment, Ohnmacht empfinden zu wollen. Er will geschlagen werden, nicht nur selbst schlagen. Das wird im Stück vom Chef als Schwachpunkt benutzt. Vor kurzem gab es einen Film über Adolf Hitler, in dem man über Psychologie und seine Sexualität an sein Modell von Macht herankommen wollte; alles Mögliche wurde vorgebracht, um zu zeigen, daß er ein Masochist war, der sich peitschen ließ. Warum konnte so jemand so viel Macht verkörpern? In meinem Stück ist ähnlich, daß jemand, der nach sehr viel Macht strebt, sich auf der anderen Seite demütigen und zum Schwein machen lassen will. Das ist letztlich nichts besonderes, es ist alltäglich, ich denke, das steckt in jedem drin, nur lebt es jeder anders aus.
Sie haben sich auch an Comics inspiriert. So waren die Detektive aus der Comicserie „Tim und Struppi“, Schulze und Schultze, Vorbilder für Maggi und Meggo.
Die beiden sollten nahezu eine Identität haben, der eine als Schatten des anderen. Sie sind die Handlanger des Chefs, machen aber alles, was ihnen der Chef aufträgt, falsch, bloß, daß in dieser falschen Welt das Falsche plötzlich völlig richtig wird. Ihre Aktionen scheitern immer, da ist sehr viel Slapstick drin und steigert sich bis zur Brutalität, aber minus mal minus wird plus, ein PR-Erfolg, weil sie Aufsehen erregen, egal, was sie machen.
Im Stück verkleiden sich die Aktivisten bei ihren Aktionen als Zwerge. Wofür stehen die Zwerge?
Auf die Zwerge kam ich – auch da brauchte ich nichts zu erfinden –, als hier im Saarland eine Bierfirma ein Plakat mit einem Zwerg drauf hatte. Zur gleichen Zeit lief die Landtagswahl, und das Zwergenplakat sah man immer neben den Plakaten der Politiker. Ob das Absicht war, Dummheit oder Gerissenheit, weiß ich nicht. Neben den Politikern war immer wieder ein Plakat, auf dem stand: „Auf geht’s zum Zwerg“. Da kam ich auf den Zwerg als Symbol, das ja für vieles steht, nicht nur für Beschränktheit, Provinzialität. Wir haben im Saarland die Bergwerke, und auf mittelalterlichen Bildern von Bergwerken gibt es immer die Wichtelmänner, die Zwerge. Die Zwergenwelt war für mich wichtig, weil Dieses.Kleine.Land. auch ein deutscher oder saarländischer Vorgarten sein könnte, in dem sich alles abspielt. Das könnte man auch übertragen.
Sie bieten in Ihrem Stück keinen Entwurf an für das Eigene, sondern Sie konfrontieren zwei falsche Modelle von „Identität" miteinander. Steckt darin nicht ein moralischer oder ethischer Impuls, der ex negativo auf etwas verweist, was das Eigene sein könnte?
Klar ist, daß in diesem Stück keine Lösung oder Formel für Identität oder Heimat gegeben wird, sondern die Infragestellung deren Mißbrauchs. Ich habe in vielen Arbeiten, ob das Lieder oder Filme sind, gezeigt, was in diesem unserem kleinen Land zu pflegen wäre. Ich lebe durchaus vertikal hier... Ich würde aber nicht sagen, man sollte eine Beschränktheit hochstilisieren zum Heimatbegriff. Da bin ich durchaus der Meinung, daß es keine Heimat sein kann, die sich abschottet und die nicht davon lebt, daß sie sich verändert in ihrem Bewußtsein. Das wird nicht gern gehört. Man hört viel lieber: „Ich bin ein Saarlouiser all mein Leben“ und so, diese Liedchen. Übrigens: Die beliebtesten Fernsehsendungen, die unter Ceausescu liefen, waren Heimatsendungen, wo sie vorm Brunnen saßen, Kartoffeln geschält haben, und hinten wurden Volkslieder gesungen. Gleichzeitig hat er ganze Dörfer wegrasiert und Plattenbauten hingestellt. Also, dieses „Kein schöner Land“, oder dieses „Eine bessere Scholle findst du nit“... – dagegen wehre ich mich. Das hört man nicht gern. Kultur wird nicht als kritische Kultur gewollt; wirkliche Kultur, die wehtut, weil sie in Frage stellt, wird nicht gewollt. Wir (die Künstler) werden – überall – gern als Garnierer von irgendwelchen politischen Inhalten benutzt, vor Wahlen vor allem. Aber daß Kultur Reibefläche ist, wo es auch mal brennt, das wird nicht gefördert und nicht gewollt.
„Ich brauche nichts zu erfinden...“
Michael Birkner im Werkstattgespräch mit Alfred Gulden
Gollenstein Verlag, Blieskastel
*
Michael Birkner, Theaterzeit, Saarbrücken, November 2006
Benno von Skopnik, Die Welt, Bonn, 22.11.2005
Christoph Schreiner, Saarbrücker Zeitung, 21.11.2005

Die Schauspieler agieren einmal streng im Gleichschritt und korrekt wie ein Uhrwerk. Im nächsten Moment sind sie wild und ausgelassen wie eine Punkrockband.
Bei der Uraufführung der Groteske Dieses. Kleine. Land. zeigte das Ensemble des Saarländischen Staatstheaters am Freitagabend über zwei Stunden hinweg körperliche und stimmliche Höchstleistungen. Das von dem aus Saarlouis stammenden Schriftsteller Alfred Gulden geschriebene Stück soll zeigen, wie Heimat und Identität mißbraucht werden kann.
Bei der Umsetzung hat der Schweizer Theater- und Filmregisseur Urs Odermatt den Schauspielern viel abverlangt und auch den Zuschauern einiges zugemutet. Das Publikum honorierte die Leistung dennoch mit viel Applaus.
Dieses. Kleine. Land. hatte das Saarländische Staatstheater im Jahr 2003 bei Gulden in Auftrag gegeben. Damals war das 50. Jubiläum des Saarreferendums, das am 23. Oktober dieses Jahres gefeiert wurde, in Sicht. Am 23. Oktober 1955 hatten sich die Saarländer für die „kleine Wiedervereinigung“ mit Deutschland und gegen eine weitere Autonomie ihres Landes entschieden. Gulden wollte das Stück aber nicht im Historischen, sondern in einem modellhaften kleinen Land ansiedeln.
Das kleine Land soll aufgelöst werden. Dagegen gibt es heftigen Widerstand. Der „Chef“ (Michael Hiller), der nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt und keine Hände mehr hat, kämpft fanatisch für die Unabhängigkeit. Darsteller Hiller, der die meiste Zeit in einer Inkontinenz-Unterhose und eingewickelt in Frischhalte-Folie im Rollstuhl sitzt, schlüpft in verschiedenste Identitäten, spricht längere Passagen Russisch und imitiert beeindruckend Politiker von Adolf Hitler bis Erich Honecker.
Der „Chef“ holt sich den ehemals berühmten und inzwischen dem Alkohol verfallenen „Dichter“ (Maximilian Wigger) an seine Seite, damit er die Ideen und Aktionen in schlagkräftige Worte packt. Der Gegner und „Widersacher“ (Marcel Bausch) des „Chefs“ ist ein Emporkömmling, der in Wirtschaftskreise aufgestiegen ist und an der Auflösung des kleinen Landes arbeitet. Der Chef und sein Widersacher hassen einander seit ihrer Jugend. Ihr Machtkampf reißt persönliche Abgründe auf.
Gespickt ist das Stück mit dutzenden unverhofft vorgetragenen Schlager- und Volkslied-Bruchstücken, Fußball-Parolen und Werbesprüchen. Melodien bekannter klassischer Musik gackern die Figuren nach wie Hühner. Der Text der deutschen Nationalhymne wird ersetzt durch Texte wie „Laßt das Monster auf die Bühne“.
Uraufführung von „Dieses. Kleine. Land.“ gefeiert
dpa, 19. November 2005
*
Kleine Länder gibt es reichlich auf unserem Globus. Als Saarländer lebt man in einem davon. Und um ein solches geht es im Stück Dieses. Kleine. Land., welches jetzt in der Alten Feuerwache in Saarbrücken uraufgeführt worden ist.
Kurz zum Inhalt: Die Unabhängigkeit eines kleinen Landes ist gefährdet. Es herrscht der nationale Ausverkauf. Der Chef einer Untergrundbewegung plant von seiner Zentrale aus Aktionen dagegen. Diese läßt er von seinen Handlangern ausführen. Denn er selbst ist nach einem Unfall ein Totalkrüppel und sitzt im Rollstuhl. Diese Reduktion auf „Kopf und Schwanz“ sieht er jedoch geradezu als Segen, ist sie doch eine Konzentration auf das Wesentliche. Was ihm noch fehlt, ist jemand, der die hehren Ziele der Organisation in wohlfeile Worte faßt. Zu diesem Zweck heuert er den Dichter an, der – ehemals eine Berühmtheit – heute zum versoffenen Bierdeckelpoeten verkommen ist.
Dieses. Kleine. Land., eine Auftragsarbeit des Saarlouiser Schriftstellers Alfred Gulden, befaßt sich mit dem Für (Erhaltung) und Wider (Eingliederung) kleiner Länder, dem Wahnhaften einseitiger Ideen sowie dem Verfolgen persönlicher Interessen. Als Mittel bedient er sich hierbei der Groteske, driftet gelegentlich sogar ab ins Absurde. Das Stück stellt sowohl die Schauspieler, als auch die Zuschauer vor eine große Herausforderung. Die Schauspieler haben sie am Premièrenabend schon mal mit Bravour gemeistert, wobei Michael Hiller als „Der Chef“ besonders hervorsticht.
Provokation kommt nicht nur wiederholt, sondern quasi unentwegt zur Anwendung. Tatsächlich beschleicht einen der Gedanke, ob der Autor wohl ausloten wollte, wie viel obszöne Worte und Formulierungen sich in einem Skript unterbringen lassen. Der provokante Ansatz wurde seitens des Regisseurs Urs Odermatt auch freudig aufgegriffen und weitergeführt, wobei manches wohl verpufft.
Das Stück bricht radikal nicht nur mit moralischen, sondern auch mit Sehgewohnheiten. Nicht nur auf der Bühne, sondern rund um den Zuschauer spielt sich die Handlung ab. So dürfte vielen Premièrenzuschauern entgangen sein, daß der Dichter plötzlich nackt im Publikum stand. (...) Dieses. Kleine. Land. ist Theater für den Kopf. Das Stück gewinnt vor allem in der geistigen Nachbearbeitung.
Benno von Skopnik
Kopflastiges unterhalb der Gürtellinie
Die Welt, Bonn, 22. November 2005
*
Chef
Falsch. Falsch. Alles, was sie machen, ist falsch! Falsch eingestellt. Zu spät gekommen. Zu früh gezündet! Ich verfluche euch! Fahrt zur Hölle. Wo ihr hingehört! Wieso bin ich von Versagern umgeben? Wieso gelingt nichts? Es sollte unser Triumph werden! Du und ich! Im Namen des Vaters und des Sohnes hätten wir dieses kleine Land zu etwas gemacht. Zu etwas Großem! Nichts, nichts gelingt.
*
Eine geschichtliche Krisensituation hat das kleine Land in verfeindete „Lager“ gespalten. Die eine Seite, welche die Auflösung des Landes betreibt, ist weitgehend unsichtbar und in der Gestalt eines „Widersachers“ verkörpert, der an der geplanten Schließung eines Kaufhauses und von Filialen einer landeseigenen Bank beteiligt ist. Auf der anderen Seite hat sich eine Untergrundorganisation formiert, um durch spektakuläre Aktionen die Öffentlichkeit gegen den Ausverkauf und für die Verteidigung der Unabhängigkeit des Landes zu mobilisieren. Die Aktionen – das Stück beginnt mit einem Störversuch im Fußballstadion – enden zwar zunächst in Chaos und Gelächter, die Eigendynamik des Scheiterns ruft aber die Presse auf den Plan und den Zuspruch einiger Persönlichkeiten des Landes hervor, die an der Ruhestörung interessiert sind. Danksagungen gehen beim Drahtzieher und Kopf der politischen Bewegung ein, dem „Chef“. Einst ein bekannter Erfinder in diesem kleinen Land und seit einem Unfall ein „Totalkrüppel“ im Rollstuhl, dirigiert und überwacht er von einer Zentrale aus die Operationen. Animiert durch die unerwartete Resonanz, greift er bald zu härteren Mitteln und läßt durch seine Handlanger unter Gewaltandrohung einen Dichter zu propagandistischen Zwecken anheuern und einen pressewirksamen Bankraub durchführen. Die Grenze zwischen politisch-theatralem Happening und realem Gewaltakt wird dabei immer durchlässiger, je obsessiver der Wille des Chefs nach einem politischen Richtungswechsel sich auf die Degradierung und schließlich die Vernichtung seines Feinds, des „Widersachers“, richtet.
Die Gegenspieler hassen einander seit ihrer gemeinsam verbrachten Kindheit – ihr Machtkampf läßt das Krebsgeschwür kenntlich werden, das in jeder Form von Politik aufbricht, die sich auf den Willen zum bedingunglosen Machtgewinn reduzieren läßt.
Der bekannte saarländische Schriftsteller und Filmemacher Alfred Gulden hat Dieses. Kleine. Land. als Auftragsarbeit für das Saarländischen Staatstheater geschrieben, zum 50jährigen Jubiläum des Saarlands als Bundesland. Das „kleine Land“ in seinem Stück ist modellhaft konstruiert und keine Abbildung bestimmter regionaler Verhältnisse. Gleichwohl lassen sich einzelne Motive auch auf das Saarland beziehen. In seinem Nachwort zum Programmbuch, das auch einen Stückabdruck enthält, schreibt der Literaturwissenschaftler Karl Richter: „Das Stück reagiert auf das Umsichgreifen eines Regionalismus, der sich zum Provinzialismus verengt. Es kritisiert eine Berufung auf Heimat und Unabhängigkeit, die nicht mehr menschliche Befindlichkeiten und kulturelle Bedürfnisse, sondern eine Ideologie im Dienste des Machterhalts deckt. Aber es kritisiert auch Forderungen einer Auflösung, die sich nur als Anti-Ideologie erweisen. Das eine erscheint als Verschanzung in einer verlogenen Idylle, das andere als verlogene Flucht. Beide werden als Alternativen einer falschen Identität verworfen.“ Daß die Entdeckung des Eigenen in keinem Ausschließungsverhältnis zur Erfahrung des Fremden bestehen kann, sondern das Eine das Andere voraussetzt, darauf verweist Guldens Stück durch die groteske Überzeichnung eines defizitären Heimat- und Identitätsverständnisses.
Regie führt der Schweizer Theater- und Filmregisseur Urs Odermatt, der die Musikalität der Sprache Guldens mittels einer polyphonen Komposition herausarbeitet und das Groteske der Figuren und der Handlung durch eine theatrale Filmschnitttechnik unterstreicht. Das Bühnenbild und die Kostüme entwirft Dirk Seesemann. Beide haben im Jahre 2002 das Stück Die Bauchgeburt in der Alten Feuerwache erfolgreich zur Uraufführung gebracht. (...)
Michael Birkner, Dramaturg