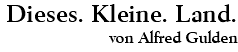Kleine Länder gibt es viele, überall auf der Welt und seit alters her. Der Wille zur Eigenständigkeit, die Liebe zum eigenen Land und seinen Menschen sowie ein gewisser Regionalstolz geraten in diesen kleinen Ländern nicht selten in Widerspruch zur Möglichkeit einer Auflösung in einen größeren Staatenverbund und der Erweiterung der Perspektiven. Innere Zerrissenheit und Widersprüche in sich selbst (wie kann man das Eigene lieben, wenn man sich gegen das Andere abschottet und umgekehrt?), die Spaltung in fanatische „Regionalisten“ und „Globalisierer“ dient dabei häufig den Machtinteressen einzelner, die Land und Leute zu ihren Zwecken instrumentalisieren. Daß das Politische oft privat motiviert ist, bildet einen Ausgangspunkt von Alfred Guldens Stück Dieses. Kleine. Land. Es problematisiert das Pro und Contra (Auflösung oder Unabhängigkeit) zum Modell eines kleinen Landes und hinterfragt das Wahnhafte einseitiger Lösungen (Verlust oder das plakative Überstrapazieren von Identität) ebenso kritisch wie deren Mißbrauch im persönlichen Machtkampf einzelner. Alfred Guldens Theaterstück verweist durch die groteske Darstellung eines defizitären Heimat- und Identitätsverständnisses darauf, daß „Welt“ wie „Winkel“ in keinem Ausschließungsverhältnis zueinander bestehen können, sondern daß das Eigene nur über die Erfahrung des Fremden, das Fremde nicht durch die Aufgabe des Eigenen entdeck- und lebbar ist.
Die Handlung in Kürze: Eine geschichtliche Krisensituation hat das von Alfred Gulden modellhaft konstruierte „kleine Land“ in verfeindete Lager gespalten. Gefährdet ist seine Eigenständigkeit. Die eine Seite, welche die Auflösung des Landes betreibt, ist weitgehend unsichtbar und in der Gestalt eines „Widersachers“ verkörpert, der an der geplanten Schließung eines Kaufhauses und von Filialen einer landeseigenen Bank beteiligt ist. Auf der anderen Seite hat sich eine Untergrundorganisation formiert, um durch spektakuläre Aktionen die Öffentlichkeit gegen den Ausverkauf und für die Verteidigung der Unabhängigkeit des Landes zu mobilisieren. Die Aktionen enden zwar zunächst im Chaos, die Eigendynamik des Scheiterns ruft aber die Presse auf den Plan und den Zuspruch einiger Persönlichkeiten des Landes hervor, die an der Ruhestörung interessiert sind. Danksagungen gehen beim Drahtzieher und Kopf der politischen Bewegung ein, dem „Chef“. Einst ein berühmter Erfinder, seit einem Unfall aber zum „Totalkrüppel“ geworden und an seinen Rollstuhl gefesselt, überwacht der Chef die Operationen von einer Zentrale aus. Er empfindet seine Reduktion (auf „Kopf und Schwanz“, wie er immer wieder sagt) als Konzentration auf das Wesentliche. Außerdem hat er sich durch technische Apparaturen perfekte Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen. Da ihm noch jemand fehlt, der seine Ideen und Aktionen in schlagkräftige Worte packen kann, heuert er einen Dichter an, der in dem kleinen Land einmal eine Berühmtheit war, seit Jahren aber sein Dasein als Trinker und Kneipenpoet fristet. Für den Dichter eine Auferstehung, für den Chef eine „gewaltige Stimme, ein Donnerton, der dieses kleine Land aus seinem Schlaf reißen soll“. Animiert durch die PR-Erfolge, greift der Chef bald zu härteren Mitteln und läßt durch seine Handlanger einen pressewirksamen Bankraub durchführen. Die Grenze zwischen politisch-theatralem Happening und realem Gewaltakt wird immer durchlässiger, je obsessiver der Wille des Chefs nach einem politischen Richtungswechsel sich auf die Degradierung und schließlich die Vernichtung seines Feinds, des „Widersachers“, richtet. Die Gegenspieler hassen einander seit ihrer gemeinsam verbrachten Kindheit – ihr Machtkampf läßt das Krebsgeschwür kenntlich werden, das in jeder Form von Politik wächst, die sich auf den Willen zum bedingungslosen Machtgewinn reduzieren läßt.
Michael Birkner
Vorwort zum Stück
Programmheft zur Uraufführung, Saarländisches Staatstheater, Saarbrücken 2005
*
„Nur auf der Grenze bin ich zuhaus’“, hatte Alfred Gulden seine 1982 erschienene Sammlung von Aufsätzen überschrieben. Die Verwurzelung an der Grenze macht den Wert von heimatlicher Geborgenheit darin bewußter erfahrbar. Im neuen Drama Guldens begünstigt sie eher den skeptischen Blick, der sich gegen eine Verengung und politische Instrumentalisierung von „Heimat“ richtet.
Gulden hat sein Stück Dieses. Kleine. Land. für das Saarländische Staatstheater geschrieben. Es handelt von einer geschichtlichen Situation, in der die Identität eines kleinen Landes erschüttert und seine Eigenständigkeit in Frage gestellt wird. Schon sieht ein „Widersacher“ die Auflösung in einen größeren Staat als einzigen Ausweg aus dem geschichtlichen Dilemma. Gegen ihn tritt der Chef, die zentrale Gestalt des Stücks, kompromißlos für „Heimat“ und „Unabhängigkeit“ ein. Von seiner Zentrale aus steuert er Aktionen, die diesem Ziel dienen sollen. Seine Organisation verfügt über Geld und Macht. Von einer politischen „Bewegung“ ist die Rede, nicht einer Regierung. Doch der übersteigerte Machtanspruch des Chefs geht über denjenigen demokratischer Regierungen noch hinaus. Sein schließliches Credo: „Ich bin dieses kleine Land! (...) Was ihr mir antut, tut ihr diesem kleinen Land an! Dieses kleine Land bin ich, ich, ich!“ So soll der französische König Ludwig XIV. einst den Anspruch des absolutistischen Staats begründet haben: „L’état, c’est moi!“ Aber so ähnlich, wenn auch etwas leiser, tönt es zuweilen noch immer aus Politikern gerade auch kleiner Länder.
Das Stück kritisiert typische Strukturen einer fragwürdigen Machtpolitik. Für den Chef der Bewegung sind alle anderen nur nützliche Handlanger, seine Kopfgeburten umzusetzen. Opportunistische Erfolgshascherei, aber auch Erpressung und hemmungslose Kontrolle erscheinen ihm – gut macchiavellistisch – als legitime Mittel im Dienst seiner politischen Ziele. Die beiden „ausführenden Organe“ Maggi und Meggo haben den Zuschnitt willfähriger, für alles einsetzbarer politischer Appatschiks. Die Medien interessieren den Chef nur für Gewinne an Aufmerksamkeit. Das Volk geht nur als manipulierbare Masse in seine Überlegungen ein.
Das Politikverständnis dieser Art hat aber auch deformierte Menschen und Ideale zur Folge. Die Verkrüppelung des Chefs ist zugleich sinnlicher Ausdruck einer geistig-emotionalen Verarmung, die den Menschen auf „Kopf und Schwanz“ reduziert. Schonungslos demütigt er seine Frau. Seinen stumm gewordenen Sohn trimmt er zum „elektronischen Engel“. Die Figur der Aktivistin dient seinem politischen Programm, aber auch der Befriedigung ausschweifender sexueller Gelüste. Der Dichter soll als bestechlicher Gehilfe bei der Ausbreitung einer rückwärtsgewandten Ideologie helfen. Selbst der Widersacher hat immer zugleich die Funktion eines Feindbilds, das den eigenen Machtanspruch rechtfertigen soll. „Unabhängigkeit“ und „Auflösung“ bedingen einander als entgegengesetzte Alternativen, entlarven sich aber auch wechselseitig. Die politisch eigenständige Heimat wie umgekehrt das Aufgehen in einem größeren Ganzen erscheinen bei aller Gegensätzlichkeit als nahezu austauschbare Ideologeme im Dienste der Macht. „Wie ihr euch gleicht!“, kann die Gattin des Chefs ernüchtert feststellen. Das ausgeblendete Natürlich-Menschliche holt beide Protagonisten nur noch im Zwanghaften sadistischer und masochistischer Exzesse ein. Sie versinnbildlichen die Selbstbezogenheit des Machtstrebens und stellen jeden sozialen Anspruch auch auf diese Weise in Frage.
In bald sehr direkter, bald eher versteckter Weise macht das Stück auch Beziehungen von Politik und Theater zu seinem Thema. Mit dem bewährten „Seid ihr alle da?“ hatte ein Kasper die erste politische Aktion des Stücks eingeleitet; und mit den gleichen Worten wendet sich der Chef später an seine Helfer. In Zwergenmasken und -kostümen versuchen Maggi und Meggo zuerst einem Fußballspiel, dann einer Klassikaufführung eine neue Wendung zu geben. „Weg, weg, weg – der Staatstheaterdreck“ ist auf einem Transparent zu lesen. Doch solche Aktionen werden ihrerseits als Theater im Stil der „Schaubude“ geboten. An zahlreichen Stellen werden auch Filme eingespielt. Das Bühnengeschehen wird also in vielfältiger Weise zum „Spiel im Spiel“ gebrochen. Doch im Zusammenhang des übergreifenden Bühnenvorgangs erzeugen diese Brechungen kritische Distanz. Kasperl- und Zwergentheater entlarven politisches Format, die filmischen Einspielungen die Kontrollbedürfnisse der Macht. Seine Gesellschaftskritik macht den Autor in versteckter Weise zum Gegenspieler der politisch instrumentalisierten Dichterfigur. In seiner kritischen Leistung und literarischen Gestaltungskraft bewahrt das Theater gegen alle aktuellen Anfechtungen trotziges Selbstbewußtsein und kraftvolles Leben.
Das Stück versteht sich als satirische Groteske. Sie arbeitet mit Übertreibungen, schroffen Kontrasten und grellen Bildern. Vor allem in der Gestalt des Chefs, der mit seinem Rollstuhl verwachsen scheint und ihn handhabt wie ein Herrschaftsinstrument, aber auch in Maggi und Meggo begegnen jene grotesketypischen Mischungen von Mensch und Apparat. Sie rufen ein Lachen hervor, das im Halse stecken bleibt. Die karge, aber bewegliche Sprache signalisiert bald autoritäres Befehlsgehabe, bald Gehetzt- und Getriebensein, bald reduzierte Kommunikation. Die vielen regionalen Anspielungen erfahren eine abstrahierende Verallgemeinerung zum literarischen Modell.
Friedrich Dürrenmatt sah gerade kleine Länder wie die Schweiz berufen, eine Dramaturgie der Modelle mit weitem geschichtlichen Geltungsanspruch hervorzubringen. Alfred Gulden bestätigt vom Saarland aus eine solche Disposition. Dieses. Kleine. Land. ist als dramatisches Modell ein abstrahierendes Konstrukt, keine Beschreibung einer geschichtlichen Wirklichkeit. Aber die Bausteine des Modells sind der regionalen Wirklichkeit entnommen. Das gilt für die allgemeine Antithese von Eigenständigkeit und Auflösung, aber auch für weitere thematische Strukturen. So haben auch die Theaterkonflikte ihre bekannte regionale Aktualität. Umgekehrt sind die guten Beziehungen der Politik zum Fußball parteiübergreifende Tradition. Auch jenes „Ich-bin-der-Staat-Bewußtsein“ wurde Politikern des Landes schon quer durch die großen Parteien nachgesagt.
Dramatische Modelle deuten eine geschichtliche Wirklichkeit, aus der sie erwachsen sind, aber sie legen ein Stück nicht allein darauf fest. Zum Status eines Modells gehört seine Übertragbarkeit. Das „kleine Land“ meint das Saarland, aber andere kleine Länder mit vergleichbarer Problemlage ebenso. Es wird auch vom Spielort abhängen, welche geschichtlichen Erfahrungen ein Zuschauer dem Modell unterlegt. Saarländische Zuschauer dürfen regional Vertrautes darin gespiegelt und kritisiert sehen. Aber sie sollen auch jenen Überschuß nicht verkennen, der am Beispiel des Saarlands zugleich ein allgemeineres Problem meint.
Die Jahrzehnte seit dem Zweiten Weltkrieg hatten die überschaubare Einheit der „Region“ als Ort eines noch unverbrauchten Heimatgefühls wie als Hort kulturellen Reichtums entdeckt. Das Saarland kann geradezu als Paradigma gelten, wie weit solcher Reichtum auch ein grenzüberschreitendes Bewußtsein voraussetzt. Dieses Zugleich von traulicher Nähe und weltbürgerlicher Weite sieht Gulden in mehrfacher Weise gestört. Sein Stück reagiert auf das Umsichgreifen eines Regionalismus, der sich zum Provinzialismus verengt hat. Es kritisiert eine Berufung auf Heimat und Unabhängigkeit, die nicht mehr menschliche Befindlichkeiten und kulturelle Bedürfnisse, sondern eine Ideologie im Dienste des Machterhalts deckt. Aber es kritisiert auch Forderungen einer Auflösung, die sich nur als Antiideologie erweisen. Das eine erscheint als Verschanzung in einer verlogenen Idylle, das andere als verlogene Flucht. Beide werden als Alternativen einer falschen Identität verworfen.
Es gehört zum Irritierenden des Stücks, daß es seine Forderungen nur indirekt an der Kritik entgegengesetzter Lösungsvorschläge zum Ausdruck bringt. Eine sinnvolle Vermittlung des Auseinanderstrebenden wird von keiner der Figuren geleistet. Gerade das aber spielt dem Zuschauer die Aufgabe zu, die frei gelassene vermittelnde Position einzunehmen. Er soll die politisch-ideologischen Ziele der Figuren auf ihren menschlich-sozialen Wahrheitsgehalt hin befragen, das Zugleich von Nähe und Weite mehr denn je als Aufgabe der geschichtlichen Stunde begreifen.
Guldens Stück ist kein bequemer Beitrag zum bevorstehenden 50jährigen Jubiläum des Saarlands. Es betreibt eine schmerzhafte Standortbestimmung. Doch es will die Region gerade damit vor einem unzeitgemäßen Provinzialismus bewahren helfen. Das Stück ist in diesem Sinne ein zukunftsweisender Beitrag zu einer saarländisch-deutschen Kultur im Herzen Europas.
Prof. Dr. Karl Richter
„Unabhängigkeit“ oder „Auflösung“?
Alfred Guldens Groteske „Dieses. Kleine. Land.“
Gollenstein Verlag, Blieskastel

Das Stück verhandelt Pro und Contra von Auflösung / Verlust von Identität und Eigenständigkeit oder Unabhängigkeit / Übersteigerung des Heimatgefühls am Modell eines kleinen Landes. Die Handlung: Der Chef einer Untergrundorganisation plant Aktionen, engagiert einen Dichter. Kontrahent des Chefs ist ein in Wirtschaftskreisen Erfolgreicher, der an der Auflösung des Landes arbeitet. Der Machtkampf – auch um eine Frau – reißt ungeahnte Abgründe auf.
*
Inwieweit haben Sie ein Schlüsselstück geschrieben? Ist es möglich, die eine oder andere Figur der saarländischen Polit- oder Promiszene wiederzuerkennen?
Das ist kein Stück, in dem Sie hiesige Politiker wiedererkennen können. Als ich die Endfassung schrieb, waren mir die balkanesischen Verhaltnisse – ein Tudjman, etwa – viel näher als die saarländischen.
Und hinter dem Chef der Unabhängigkeitsbewegung steckt nicht etwa ein Oskar Lafontaine, mit dem Sie ja befreundet sind? Oder im Dichter ein bißchen Gulden?
Die Figuren sind nicht nach intimen Kenntnissen real existierender Politiker geformt worden. Sie tragen viel mehr ein Narrenkleid aus Charakterfetzen verschiedener Politgrößen. Aber es sind natürlich deren Argumente und Denkweisen als dokumentarisches Material verarbeitet und verdichtet worden.
Also gibt’s keine Enthüllungen?
Keine. Das wäre doch wohl auch zu simpel und zu plakativ. Aber halt: Für zwei Figuren gibt es tatsächlich ganz konkrete reale Vorbilder, saarländische sogar. Die beiden Mitarbeiter des Chefs, Maggi und Meggo, gab’s wirklich. Sie waren stadtbekannte Obdachlose in Saarlouis.
Cathrin Elss-Seringhaus
Oskar Lafontaine kommt nicht vor
Gespräch mit Alfred Gulden
Saarbrücker Zeitung, 20. Oktober 2005
*
Dichter
Trinken. Irgendwo hier muß es doch etwas zu trinken geben. Dringend. Trinken. Ich brauche dringend etwas zu trinken. Weinbierschnaps. Egal. Wo bin ich hier überhaupt? Zum Teufel, wo bin ich hier? Herrgottnocheins, das Pissoir. (hält sich den Kopf) Das Pochen. Vorschlaghämmer. Das haut rein. Immer dieselbe Stelle. (faßt sich an den Hinterkopf) Da. Genau da. (tastet ab) Das Pissoir. Dann, ja, im Bett in einem weißen Zimmer. Dann die Erscheinung. Die Frau. Diese Frau. „Deine Fee. Deine gute Fee.“ Ich kenne sie. Ich hab’ sie sofort erkannt. Woher? – Das muß lange her sein. (taumelt, setzt sich auf einen der Stühle am Tisch, klopft mit zittrigen Händen auf den Tisch; lautlos ist der Chef hereingerollt, beobachtet den Dichter) Trinken. Dringend. Ich brauche etwas zum Trinken. Hier muß es doch etwas zum Trinken geben. Egal was, Weinbierschnaps, Weinbierschnaps, egal.
Chef
Wasser. Tee. Kaffee. Säfte. (der Dichter dreht sich zum Chef um) Milch.
Dichter
Alkohol, etwas mit Alkohol. Dringend!
Chef
Wasser. Tee. Kaffee. Säfte. Milch.
Dichter
Trinken.
Chef
Du Bierdeckeldichter, Du Schnapsdrosselsänger, schau dich an! Widerlich! Schau mich an! Was gäbe ich dafür, deinen Körper zu haben! Und du, du zersäufst dir dein Hirn. Ein Brei, dein zersoffenes Hirn, ein Brei!
Dichter
Wer sind Sie, wie kommen Sie dazu? Ich will weg hier. (der Chef läutet, Maggi/Meggo erscheinen) Weg.
Chef
Schafft ihn auf sein Zimmer. (Maggi/Meggo packen den Dichter hart an, schleifen ihn hinaus) Mein Mann, das ist mein Mann. Das wird schon. Das wird wieder. Das wird noch.
*
Chef
Dichter, schau her! Schau her! Schau genau hin! Was siehst du? Was? Du siehst ein Stück Fleisch. In einem Rollstuhl. Ein Stück Fleisch. Ohne Arme. Ohne Beine. Ohne Gesicht. Das bin ich. Das ist von mir übrig. Ein Totalkrüppel. (zitiert, den Dichter nachahmend) Armselig. Ein Wurm. Der Spott der Leute. Und die Verachtung des Volks. Biblisch. Das war nicht immer so. Ich war sportlich. Gute Figur. Sehr gute sogar. Es gibt Photos. Auch Filme. Ich war bekannt. Hatte einen Namen. Ja. Meine Stimme hatte Gewicht in diesem Land. Man hat auf mich gehört. Ich habe Geld gemacht. Sehr viel sogar. Mit meinen Patenten. Immer aufwärts. Alles lief wunderbar. Bis zu dem Tag. Diesem Tag. Ich war an einer Erfindung. Eine Erfindung, eine Revolution. Sie hätte nicht nur mir, sie hätte auch diesem Land, unserem Land, Wohlstand gebracht. Hätte. Hätte. Auf einen Schlag. Auf einen Schlag. Die Explosion. Und das, was du hier siehst, ist übrig geblieben davon. Das. Ein Stück Fleisch. Aber, jammere ich? Trinke ich mich zu Tode? Nein. Ich mache das beste daraus. Versuche es. Kopf und Schwanz. Das ist noch dran an diesem Stück Fleisch. Kopf und Schwanz. Alles darin konzentriert. Die Erfindung? Alles zerstört. Hätte. Hätte. Ja. War noch nicht soweit. Jetzt sind andere weiter vorn. Die werden es machen. Anderswo. Nicht hier. Andere, die dieses kleine Land, unser kleines Land, nicht lieben. Ach, nicht einmal kennen. Denen es gleichgültig ist, was damit geschieht. Unser Land. Wir, wir beide hängen an ihm, oder nicht? Uns ist es nicht gleichgültig, was damit geschieht! Da gibt es andere, hier in diesem Land, die ganz anders darüber denken. Und nicht nur denken. Sie sagen es auch. Und sagen es nicht nur, sie tun auch alles dafür, daß dieses Land langsam aber sicher verschwindet. Die es nullundnichtig machen wollen. Besonders einer. Einer, den ich hasse. Hasse wie nichts sonst auf der Welt. Er ist ein böser Geist. Mein Widersacher. Wir kennen uns seit Kind. Mein Erbfeind. Ein Großkotz. Dem unser Land im Weg ist, zu klein, zu unbedeutend. Hoch hinaus will er. Er und noch einige andere. Dichter, wir, wir beide, wir lieben dieses Land. Unser Land. Oder nicht? Und jetzt wollen sie es zu Grunde gehen lassen. Jetzt soll es aufhören. Weg. Aufgelöst werden. Ich kenne ihn, diesen Teufel, ihn und seine Leute, die das wollen. Ich kenne sie genau. Ihre Gründe. Ihre Absichten. Ihre Methode. Wollen wir das? Können, sollen wir das zulassen? Neinnein. Dichter, denk nach. Unser Land. Dieses kleine Land. Dafür werden wir kämpfen. Kämpfen. Wir, wir beide. Dichter. Wir sind nicht die einzigen. Auch ich, ich habe meine Leute. Überall in diesem Land. Und ich habe Geld. Genug. Wir müssen etwas tun. Tun! Wir werden etwas tun. Dagegen. Gegen ihn und seine Leute, Dichter. Aktionen. Aufmerksamkeit erregen. Den Leuten in diesem Land die Augen öffnen. Sie in ihrer Lethargie stören. Aufschrecken. Auf die Probleme hinweisen. Zeichen setzen. Du wirst sehen.