Menschen werden geboren mit der Fähigkeit zur Hingabe, und darum brauchen sie Leidenschaften. Lebensinhalte. Perspektiven. Wo sie fehlen, da schlägt Sehnsucht schnell in Sucht um. In Schottland fehlen sie häufig. Die Landschaft ist schön, das Land siecht dahin: die Arbeitslosigkeit grassiert, die Armut greift um sich, das soziale Netz ist gespannt zum Zerreißen, die Lage scheint hoffnungslos. Wo dem Leben der Sinn fehlt, wird der Zeitvertreib geboren. Ein beliebtes, wenn auch stumpfsinniges Hobby ist das Trainspotting, das Warten, Wetten und Werfen auf Dieselloks. Doch es gibt auch andere, weniger harmlose Vergnügungen. Was für einen echten Trainspotter die Lok, das ist für Mark Renton der Trip. Mark ist ein gläubiger Polytoxicomane. Er läßt sich keinen Zug, keinen Schluck und keinen Schuß entgehen. Er lebt wie ein Fakir an der Schwelle zum Tod, immerzu auf dem Sprung. Sein Leben hat er so wenig unter Kontrolle wie seinen Schließmuskel. In seinen Träumen steckt er bis zum Hals im Klosett, und beim Aufwachen geht es ihm beschissen im Sinne des Wortes. Aber der Trainspotter in Mark sieht seinen Zug noch nicht abgefahren. Irgendwann, denkt er, wird er clean werden und ohne den Stoff auskommen. Vielleicht. – Das Thema Drogen ist kein Thema der Randgruppen. Es trifft das Herz unserer Gesellschaft. Wer nicht selbst abhängig ist, kennt zumindest jemanden. Die Frage ist, ob wir es wissen wollen. Irvine Welsh zeigt uns die Junkies mit liebevoll kritischem Blick als das, was sie sind: Menschen wie wir. In der Schweiz war dieses ungemein wichtige, bewegende, verstörende und witzige Jugendstück noch nie auf dem Theater zu sehen. Es ist dringend Zeit, daß sich das ändert.
*
Es kann einem schlecht werden von diesem Text. Es kann einem schlecht werden bei diesem Thema. Wer die Karriere des Stoffs Heroin verfolgt, mag sich fragen, was den höheren Ekelfaktor hat: Die Wortschwalle der Junkies bei Irvine Welsh, in denen von schwarzen Gebärmutterschleimfäden die Rede ist und davon, wie sich einer durch einen Haufen Scheiße zu seinen Opiumzäpfchen durchwühlt, oder der blutrote Faden der Geschichte einer Heldendroge, die sich aus den Zentren nationalen Selbstbewußtseins, aus Medizin und Militär durch die Stacheldrahtverhaue zweier Weltkriege an den Rand der Gesellschaft vorgerobbt hat. Trainspotting: Das heißt wörtlich „Züge gucken“, es heißt aber unter Junkies auch „eine Vene finden“. Im Bezug auf Heroin kann es heißen, die Hand an den Puls der Gesellschaft zu halten. Was wir da fühlen, ist das Ticken einer Zeitbombe. Der lebensvernichtende Sprengstoff im Inneren heißt Heldentum, HeroInismus. Du sollst ein guter, ein besserer, der beste Mensch sein (der schönste, schnellste, stärkste, coolste, klügste, reichste, geilste etc.). Lebe als Heldin, sei ein Held. Hab’ ein schlechtes Gewissen, wenn du das nicht bist. Beneide die anderen, sei wie sie, sei besser als sie. Werde ein anderer, wenn du nicht ausreichst (und du reichst nie aus). Überwinde dich, spring über deinen Schatten, bekämpfe dich, besiege dich, tu dir Gewalt an, vergewaltige dich. Nur in Gewaltzusammenhängen werden Menschen zu Helden. Auf dem Schlachtfeld zum Beispiel. Oder auf dem Sportplatz. Oder in der Schule. Überall, wo das Prinzip Höher-Schneller-Weiter regiert. Also überall. Es ist ein Mißverständnis, zu glauben, daß Drogensucht eine Form der Verweigerung sei, daß Junkies „Nein“ zur Gesellschaft sagen. Wer Heroin spritzt, sagt „Ja“. Ja, ich will so sein wie alle, nämlich besser als alle anderen. Ja, ich will ein Held sein. Heroismus ist eine Hochglanzdroge, der wir alle verfallen sind, Medien, Motivationstrainer. Werber und Politiker sind willige Dealer. Heroin ist nur eine chemische Abkürzung, und der Schüttelfrost des Entzugs ist eine radikale Variante des heimlichen Zitterns, mit dem allen anderen bewußt wird, daß sie versagen können, versagen müssen in einer immer erbarmungsloseren Spiel-Satz-und-Sieg-Welt. Darum zeigt das Ensemble in Urs Odermatts Inszenierung die Trainspotting-Junkies nicht in der gewohnten Weise als realistisch geformte Figuren, die wir als Publikum wie eine fremde Spezies beim Fixen beobachten könnten. Darum braucht es weder Heilerde noch Randensaft, die im Theater sonst gerne Blut und Durchfall abgeben. Die Schauspieler bleiben, was sie sind, sie präsentieren einen Text, den sie nicht wie sonst mit psychologischem Subtext unterfüttern, sondern durch Aktionen – acting – in einen sozialen Kontext stellen. Dem unmittelbaren Ekel der Textgebilde stellen sie die nicht weniger ekligen Bilder einer Gesellschaft gegenüber, die Süchtige ausgrenzt und selbst noch in den privatesten Bereichen von Sucht- und Gewaltstrukturen vergiftet ist. Es geht dabei nicht darum, über die Schädlichkeit des Drogengebrauchs zu moralisieren. Was nicht gebraucht wird, ist noch ein weiterer Krieg, ein war on drugs. Es geht wohl auch nicht darum, Kinder und Jugendliche „stark zu machen gegen Drogen“. Hilfreich wäre vielleicht, sie schwach sein zu lassen, ihnen zu vermitteln, daß sie nicht immer die ersten sein, nicht immer gewinnen, gefallen, gefeiert werden müssen. Daß es okay ist, zu scheitern, zu versagen, Fehler zu machen und faul zu sein, daß es wichtigeres gibt als das Sportabzeichen und die PISA-Studie. Daß kein Mensch ein Hero sein muß, daß man als Loser mehr Spaß haben kann. Doch es ist zweifelhaft, ob wir das wollen. Dazu sind wir zu süchtig nach Siegen, zu abhängig vom Erfolg.
Jan Demuth
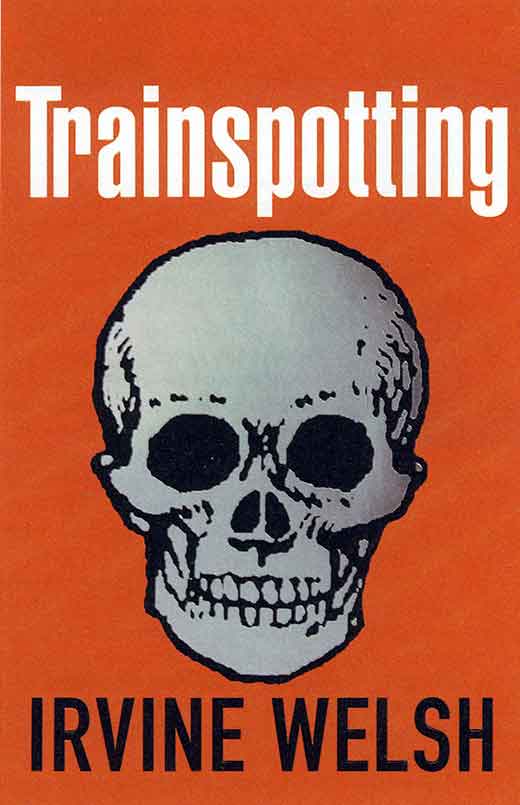
Trainspotting spielt in den trostlosen Vororten, den Siedlungen und Trabantenstädten. Es zeigt unsere Vorurteile und unsere fast unüberwindbaren Mauern zwischen den sozialen Gruppen unserer Gesellschaft, zwischen der bürgerlichen Welt und ihren Randfiguren, den Ausgestoßenen und Verlierern. Der Held von Trainspotting ist Mark Renton. Er ist ein ganz gewöhnlicher Held unserer Zeit – smart, funny, naiv, manchmal einfach unwissend, ungesund und manchmal auch gerissen. Trainspotting erzählt die Geschichte von Mark und seinen sogenannten Freunden – einem Haufen von Losern, Lügnern, Psychopathen und Junkies. Gleichermaßen grell, ausgelassen und gequält wie die Figuren, die sich scheinbar unweigerlich auf die Selbstzerstörung zubewegen, wird der Zerfall ihrer Freundschaft gezeigt. Haben sie überhaupt eine Chance aus dem Teufelskreis auszubrechen?
Trainspotting ist nicht allein ein Stück über Drogen und Gewalt, sondern eine Auseinandersetzung mit Verdrängungsmechanismen, die des Menschen, aber auch die der Gesellschaft. Es zeigt den Menschen auf der Suche, auf der Suche nach Identität, Geborgenheit, Liebe und Schutz. Hin- und hergerissen zwischen Individualität und Gemeinschaftsgefühl fängt die Clique ihn in Krisen auf, holt ihn aber auch immer wieder ein, wenn er aus ihr auszubrechen sucht. Ein Entkommen aus dem ewigen Kreislauf, der zwischen Drogen, den alten Freunden, Frustration und sozialem Abstieg pendelt, ist nur auf radikalem Weg möglich.

